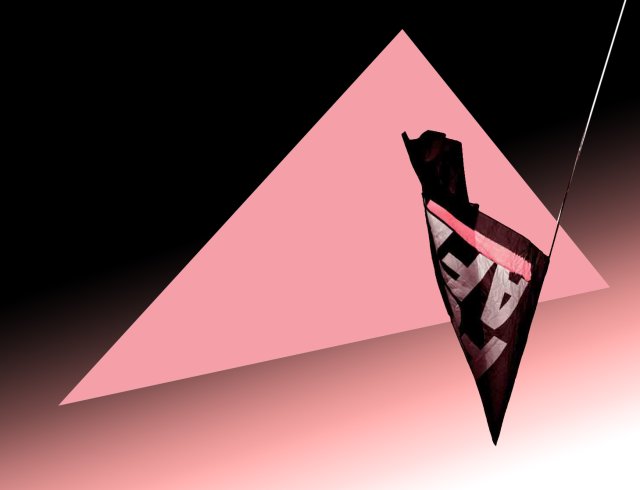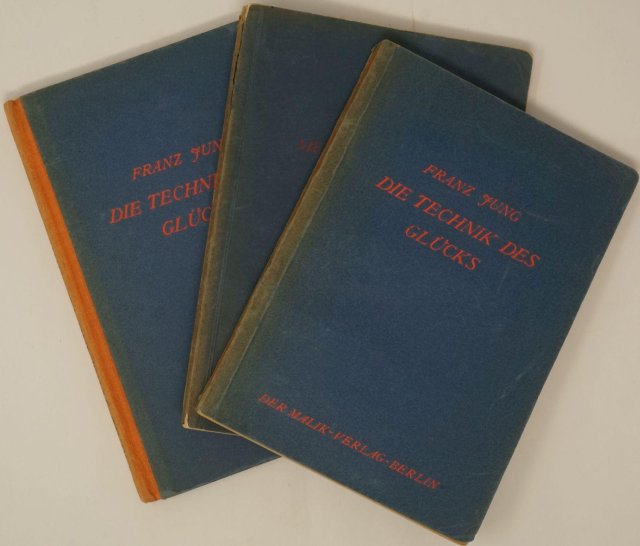Der Glaube, die Zweifel, der Schrecken
Gefeiert, verketzert, ignoriert: Vor fünfzig Jahren starb Johannes R. Becher
Er wollte in aller Stille begraben werden, ohne Reden, ohne Brimborium. So stand es in vier Testamenten. »Schweigen, nichts als Schweigen« wünschte er und in der Presse lediglich eine sachliche Mitteilung über seinen Tod. Keine Superlative. Auch die Bezeichnung »großer Dichter« verbat er sich. Müde und krank, hatte er die hochtrabenden Worte nun satt. Aber es kam alles anders. Die testamentarische Verfügung wurde ignoriert, die Beisetzung mit herbeizitiertem Trauervolk und pomphafter Heiligsprechung als Staatsakt zelebriert. Freund Ulbricht hielt die Gedenk-rede und nannte ihn gleich im ersten Satz »den größten Dichter unserer Zeit«. Es war der Schlussakt einer Tragödie, die sein Bild bis heute verfinstert.
Johannes R. Becher, in der DDR mit tönenden Reden aufs Klassikerpodest gehievt, im Westen bloß als Unperson wahrgenommen, ist schon zu Lebzeiten unkenntlich geworden. Er war nicht ganz schuldlos daran. Mit geradezu manischer Besessenheit hat er seine Lebensgeschichte so lange retuschiert, bis alle Ecken und Kanten, die Brüche und Abgründe aus der Welt waren. Auf seine genialen Anfänge als Expressionist sah er regelrecht verächtlich zurück, und gelten ließ er von seinen frühen Gedichten nur jene, die er 1929 umgearbeitet hatte. Die Darstellung seiner Kindheit und Jugend, erzählt im Exilroman »Abschied«, gibt den Gefährdungen und Krisen wohl Raum, aber auch da hat er gemildert und ausgelassen. Der Rest war ohnehin Schweigen, und nur einmal, am 1. Januar 1950, entschloss er sich zu einer Art Rechenschaftslegung, einem Tagebuch, das Aufrichtigkeit proklamierte, doch gleich auf halbem Wege stehen blieb, indem es Konflikte, Qualen, Erschütterungen ängstlich verbarg. Kein Wunder: Das scheinbar intime Journal war von Anfang an für die Öffentlichkeit bestimmt und wurde, das Jahr war kaum vergangen, schon zum Druck befördert.
Ein Becher-Bild jenseits aller Glorifizierung und Verteufelung gibt es erst seit dem Ende der DDR. Der Aufbau-Verlag, dessen Gründung auf Becher zurück geht, publizierte gleich Anfang der 90er Jahre zwei Taschenbücher, die die gespaltene Persönlichkeit unter der schöngelackten Oberfläche zeigten, auch die Risse, die platten und peinlichen Züge im Werk. Danach erschien endlich auch Rolf Harders zweibändige Briefsammlung, die wichtigste Becher-Edition der letzten Zeit, und schließlich sorgte Jens-Fietje Dwars 1998 für die erste (weit ausholende) Biografie, geschrieben, um den Lobhudeleien, den hemmungslos kolportierten Klischees und groben Verzeichnungen eine Ansicht entgegenzusetzen, die endlich zwischen Verdienst und Versagen unterscheidet. Was wir heute über den unablässig dichtenden Poeten und gläubigen Kommunisten wissen, über seine politischen Vorstellungen und Verwicklungen, die literarischen Leistungen und Entgleisungen, die ehrgeizigen Träume und privaten Katastrophen, wissen wir von ihm. Dwars hat nicht nur das beiseite geschaffte Testament und die Jenaer Krankenakte des Morphinisten ausgegraben, auch sonst förderte er in den Archiven eine Menge Neues zu Tage. Die Biografie, der er 2003 ein Aufbau-Taschenbuch mit bedeutend strafferer Lebensbeschreibung an die Seite stellte, ist das Beste, auch Fairste, was man über Becher heute lesen kann. Und er blieb dabei nicht stehen. 2004 brachte er auf eigene Kosten im quartus-Verlag eine bibliophil ausgestattete Sammlung mit den Ahrenshoop-Gedichten heraus, und jetzt hat er sich noch einmal ins lyrische Werk vertieft und für den Aufbau-Verlag aus den Bänden der Gesamtausgabe hundert Gedichte ausgewählt, die er für wichtig und haltbar hält. Das beginnt mit Teilen aus der Dichtung »Der Ringende«, der frühen Kleist-Hymne, bringt die schönsten Zeugnisse des Exils und endet mit den »Petrarca«-Strophen von 1958, Bechers lyrischem Testament. Zu sehen (und zu bestaunen) ist ein Poet, der mit seinen besten Schöpfungen aus der deutschen Lyrik des vorigen Jahrhunderts nicht wegzudenken ist, auch wenn dies heute nicht gerade zu den populären Feststellungen gehört.
Natürlich: Er war ein Mann des Widerspruchs, ein Dichter, der groß begann und sich später als matter Klassizist gefiel, ein Prosaist, der im Exil einen noch immer unterschätzten Roman schrieb (»Abschied«) und im Alter ein dürres, ungenießbares Buch über Walter Ulbricht. Er war ein Wahrheitssucher und konnte hochstapeln und lügen wie gedruckt. Er verfügte über Zivilcourage und fiel feige bei der erstbesten Gelegenheit um. Ihn faszinierte Macht, und er fürchtete sie. Er war sanft und sensibel, aber auch skrupellos. Sein Glaube an den Kommunismus wurde seit den Moskauer Exiltagen mehr und mehr von Zweifeln erschüttert, aber der Opportunismus war stärker. Er betonte, wann immer sich eine Gelegenheit bot, die Liebe zu seiner Frau Lilly und war andererseits ein gieriger Weiberheld, der sich notfalls auch im Prostituiertenmilieu bediente.
Das Ziel war früh gesteckt. Ein Großer wollte er werden. Er war achtzehn und besuchte noch das Gymnasium, als er dem verehrten Richard Dehmel seine Verse schickte, der allerdings seinen Elan zu bremsen suchte. Dichten wollte er, nichts anderes. Die Schule langweilte ihn. Seine Leistungen wurden von Jahr zu Jahr miserabler. Der Vater, Staatsanwalt und später Oberlandesgerichtspräsident in München, drängte ihn, Offizier zu werden. Er widersetzte sich, rebellierte und steuerte geradewegs dem Unheil entgegen. In einem Zigarrenladen traf er auf eine Frau, die ihm die Liebe gab, die er vermisste. Da war die Katastrophe, der beschlossene Doppelselbstmord, schon nicht mehr aufzuhalten. Am 19. April 1910 erschoss er die Frau. Er selber überlebte schwer verletzt. Der Vater sorgte dafür, dass er ungeschoren davonkam und sein Abitur machen konnte.
Becher war fürs Erste gerettet und dennoch für die gutbürgerliche Gesellschaft verloren. Er schleuderte, der Poesie verfallen und dem Rauschgift, weiter Vers um Vers aufs Papier, schwärmte für Nietzsche und Stefan George und verkehrte in der Münchner Boheme. Katharina Kippenberg, die Frau des Insel-Verlegers, gab sich redliche Mühe, den zuweilen arg verwahrlosten, freilich hochbegabten Jüngling auf den Boden der Realität zu holen. Becher, immer noch auf der Suche nach einem Halt, entdeckte erst die Religion, schlug sich dann auf die Seite der Kommunisten und beendete schlagartig die »Schwabingerei«.
Da endlich war der Platz gefunden, der die Erlösung von allen Übeln der Welt versprach, und er hat sich an die Hoffnung noch geklammert, als er, gelähmt vor Angst, in die Stalinschen Säuberungen geriet. Zweimal versuchte er, sich umzubringen. Hinterher schickte er Dimitroff und Pieck kleinlaute, devote Entschuldigungsbriefe. Den Schrecken hat er nie verloren. Er unterdrückte ihn, so gut er konnte, aber er ist bis zuletzt ein Opfer der Verhältnisse geblieben, trotz der scheinbaren Macht, über die er in der DDR verfügte. »Wem einmal das Rückgrat gebrochen wurde«, dichtete er, »Der ist kaum dazu zu bewegen, / Eine aufrechte Haltung einzunehmen, / Denn die Erinnerung / An das gebrochene Rückgrat / Schreckte ihn. // Auch dann noch, / Wenn die Bruchstelle längst verheilt ist / Und keinerlei Anlaß mehr gegeben ist, / Sich das Rückgrat zu brechen.« Publiziert hat er das Gedicht »Gebranntes Kind« allerdings nicht.
Bechers große Zeit kam 1945. Kaum aus dem Exil zurückgekehrt, versuchte er, seine Vorstellungen von einem breiten Bündnis aller antifaschistischen Kräfte zu realisieren. Er mühte sich nach Kräften, Heinrich Mann nach Ostberlin zu holen, er gründete den Kulturbund, sorgte dafür, dass man im Aufbau-Verlag Thomas Mann und Hesse drucken konnte, er kümmerte sich um den hochgefährdeten Fallada und den greisen Gerhart Hauptmann. Viele seiner Freunde, Kommunisten und Emigranten wie er, reagierten verständnislos. Er hielt die Hand über »Sinn und Form« und das Berliner Ensemble, trotzte Abusch und Paul Fröhlich, die ihm das Leben als Kulturminister schwer machten, wehrte sich tapfer gegen die Bemühungen der SED, ihren Einfluss auf die Akademie der Künste zu sichern. Er war, ablesbar an den Briefen, die namhafte Schriftsteller an ihn richteten, von Carossa über Feuchtwanger und Döblin bis zu Thomas Mann (ablesbar auch an der glanzvollen Gratulantenschar, die ihn 1951 in einem Band zum 60. Geburtstag würdigte), der kulturelle Repräsentant des meist argwöhnisch betrachteten Landesteils. Wer immer an kompetenter Auskunft interessiert war, wandte sich an ihn. Hans Mayer hat ihn aus all diesen Gründen einen »Glücksfall« für die DDR genannt. Dagegen steht etwa Bechers Versagen im Fall Harich und Janka oder sein Zurückweichen vor dem Rigorismus Ulbrichts, der allemal das letzte Wort behielt.
Für den Westen war Becher seit den Tagen des Kalten Krieges der »Staatsdichter«, eine Zielscheibe wütender Angriffe und Diffamierungen. Sein Werk, ignoriert oder als Propaganda und Kitsch abgetan, war in der Bundesrepublik kaum bekannt. Max Niedermayer, der Benn-Verleger (der 1965 im Limes-Verlag »Abschied« und einen Band mit Gedichten, Prosatexten und Dokumenten herausbrachte), und Hans Mayer (der 1975 den Lyriker in einem Band der Bibliothek Suhrkamp vorstellte) waren die rühmlichen Ausnahmen, die sich für Bechers Werk einsetzten. Peter Härtling hat, als seine Sammlung »Vergessene Dichter« mit dem Aufsatz über »Abschied« noch einmal aufgelegt wurde, in einem Nachsatz geschrieben: »An unserem Umgang mit Becher kann man studieren, wie Vorurteile zu Urteilen werden … Es ist ein deutsches Trauerspiel.« Das war 1983.
Die Sätze gelten noch immer. Oder erneut. Immerhin sollte jetzt, fünfzig Jahre nach Bechers Tod, wie Dwars im Nachwort zu den »Hundert Gedichten« sagt, »die Zeit reif sein, vorurteilsfrei das Ganze zu sichten, nach den Versen zu fragen, die uns heute ansprechen, die uns selbst zu bereichern vermögen«. Seine Auswahl ist eine wunderbare Gelegenheit dazu. Sie zeigt einen Becher, von dem die verächtlichen Verdikte nichts wissen. Im Geröll der unendlich vielen Gedichte, die er schrieb und meist auch publizierte, entdeckt sie den großen Poeten.
Müde
Müde bin ich alles dessen,
All der Pein, jahraus, jahrein,
Und ich will nichts als vergessen
Und will selbst vergessen sein.
O wie müd bin ich des allen,
All der jahrelangen Pein.
Herbstzeit ist. Die Blätter fallen.
Und wir gehn ins Dunkel ein.
Aus »Hundert Gedichte« (1948)
Auswahl
Die wenig gelungenen Stellen
Aus meinen kaum gelungenen Gedichten
Wird man auswählen,
Um zu beweisen,
Ich wäre euresgleichen.
Aber dem ist nicht so.
Denn ich bin Meinesgleichen.
So werde ich auch im Tode
Mich zu wehren haben
Und über meinen Tod hinaus
– wie lange wohl? –
Erklären müssen,
Daß ich meinesgleichen war
Und dadurch euresgleichen,
Aber nicht euresgleichen
In eurem Sinne.
Indem ich mir glich,
Glich ich euch.
Aber nur so.
Aus: Gesammelte Werke, Band 6: Gedichte 1949 – 1958
Turm von Babel
Das ist der Turm von Babel,
Er spricht in allen Zungen.
Und Kain erschlägt den Abel
Und wird als Gott besungen.
Er will mit seinem Turme
Wohl in den Himmel steigen
Und will vor keinem Sturme,
Der ihn umstürmt, sich neigen.
Gerüchte aber schwirren,
Die Wahrheit wird verschwiegen.
Die Herzen sich verwirren –
So hoch sind wir gestiegen!
Das Wort wird zur Vokabel,
Um sinnlos zu verhallen.
Es wird der Turm zu Babel
Im Sturz zu nichts zerfallen.
Aus: »Hundert Gedichte« (1949)
Johannes R. Becher: Hundert Gedichte. Hg. von Jens-Fietje Dwars. 176 S., geb., 12.95 EUR.
Jens-Fietje Dwars: Johannes R. Becher. Triumph und Verfall. Eine Biographie. 256 Seiten, br., 10 EUR. Beide im Aufbau Verlag.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.