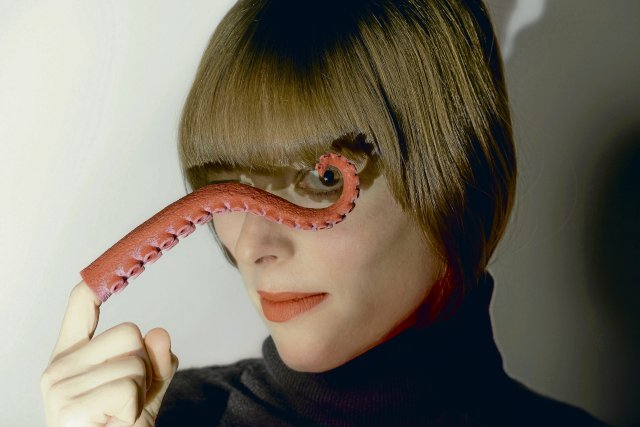- Kultur
- Reportage - Lewitz
Rappenschwarz bis schimmelweiß
Die jüngste deutsche Pferderasse kommt aus Mecklenburg. Am 1. Juli 2001 wurde sie aus der Taufe gehoben. Pferdekenner schwören mittlerweile bundesweit auf die rassigen Lewitzer Schecken.
Pferderassen gibt es viele. Araber, die kolumbianischen Paso Finos, die Lipizzaner der Spanischen Hof-reitschule, Berber, Island-Ponys, Haflinger und Percherons, um nur einige zu nennen. Ihre Vielzahl kann nicht überraschen. Denn kaum ein anderes Tier ist enger mit der Entwicklung des Menschen und seiner Kultur verbunden als das Pferd. Dass wir heute Getreide, Kartoffeln und vieles mehr für unsere Ernährung ernten, verdanken wir kultivierten und daher fruchtbaren Böden, die aber ohne die Rappen vor dem Pflug nie so ertragreich geworden wären. Ja mehr noch, die Erfindung des Rades wäre ohne die rassigen Warm- und Kaltblüter weitgehend nutzlos geblieben.
Dann aber kamen unter den Motorhauben von Traktoren die gebündelten Pferdestärken auf. Und mit ihnen drohten die treuen Wegbegleiter des Menschen in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. So schien es zumindest. Wären da nicht die zahlreichen Pferdesportarten gewesen; Spring- und Dressurreiten, Trab- und Galopprennen, der Fahrsport mit Zwei- und Vierspännern.
Beginn der Zucht in den 1970er Jahren
Vor gut siebeneinhalb Jahren wurde in Mecklenburg die jüngste deutsche Pferderasse aus der Taufe gehoben. Exakter gesagt, wurde sie am 1. Juli 2001 unter der Bezeichnung »Lewitzer« zugelassen. Und zwar von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (DRV). Ihr Namenspatron ist ein Landstrich um Neustadt-Glewe. Auf ihn trifft haargenau zu, was der Romancier und Dichter Fritz Reuter in der »Urgeschicht von Meckelborg« schrieb: »Die ersten Einwohner von Mecklenburg waren Frösche, und wer in früheren Jahren mal bei Herbst- und Frühjahrszeiten zwischen Wismar und Schwerin oder zwischen Stavenhagen und Malchin die Landstraße lang geschwommen ist, der wird mir darin recht geben, dass in solcher Mehlsuppe von Land und Wasser kein anderes Vieh existieren konnte als die Frösche.«
Nicht von ungefähr stand die Wiege der Pferde, die ihr Markenzeichen auf dem Fell tragen, in diesem einstigen Sumpfgebiet. Ulrich Scharfenorth, damals Chef des volkseigenen Gutes, hatte sich in die Gescheckten, deren Farbnuancen vom tiefsten Rappenschwarz bis zum hellsten Schimmelweiß reichen, verliebt. Ob ihn da der Hafer gestochen oder der Teufel geritten hatte, weiß er selbst so genau nicht mehr. Gern gesehen jedenfalls waren Pferde staatlicherseits nicht. Außerdem waren bis dato in unseren Breiten Schecken in der Zucht nicht erwünscht. Bei den Trakehnern wurden die Bunten sogar getötet.
Nichtsdestoweniger kaufte Scharfenorth Anfang der 1970er Jahre drei Gescheckte. Günter Sprengler aus Teterow besaß sie. Ihre Namen: Salto, Sekt und Soligirl. Mit ihnen begann er zu züchten. Was wäre der wilde Westen ohne berittene Cowboys oder Dschingis Khan ohne seine Reiterscharen, mag er gedacht haben. Vielleicht trieb ihn gar seine ostpreußische Herkunft zu diesem Husarenstück. Er stammt nämlich aus dem Nachbardorf von Trakehnen, von dem die Trakehner ihren Namen haben. Und von dort kamen ganz vorzügliche Warmblüter.
Auf alle Fälle hatte Scharfenorth mit seiner Affinität zu den Pferden das große Los gezogen. Die Kinder des Dorfes und aus der Umgebung waren den Rössern derart zugetan, dass er im Unternehmen zu keiner Zeit mehr Nachwuchssorgen hatte. Seine 30 Lehrlinge konnte er alljährlich aus einer Vielzahl von Bewerbungen auswählen. Des Chefs Pferdeleidenschaft teilten nicht zuletzt seine Mitstreiter Heinrich Warnecke, Manfred Nagel und Rolf Wullstein.
In dem Maße, wie die Lewitz immer fruchtbarer wurde, vermehrten sich auch die Gescheckten. Nicht etwa ungesteuert. Der Leipziger Professor Hans-Joachim Schwark, ein international anerkannter Hippologe, hatte eine Richtschnur für die künftige Arbeit gespannt. Ausgangspunkt für die Zucht robuster, ausdauernder aber vor allem kinderfreundlicher Ponys waren wie gesagt Tiere mit Tobianoscheckung, was heißt, dass die verschiedenen Farben im Fell in größeren Platten ausgebildet sein müssen. Außerdem wurden ein paar ausgewählte Ponyrassen in die Vermehrung einbezogen. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre entstand, wenn man so will, der wissenschaftliche Fahrplan für die Zucht der Lewitzer. Nicht zufällig kamen von 47 Hengsten, die während dieser Zeit auf ihre Tauglichkeit geprüft wurden, 14 aus dem Niederungsgebiet um Neustadt-Glewe, darunter die Plätze eins, zwei und fünf.
Charakterfest, robust und intelligent
Heute gibt es zwischen Lüchow-Dannenberg, Lauenburg, Winsen (Luhe), Salzwedel, Stendal, Perleberg, Ludwigslust, Hagenow und Nordhausen weit über 1000 Lewitzer und davon wiederum mehr als 500 eingetragene Stuten sowie 50 bis 60 Hengste, deren Zuchtbuch das Bindestrichland im Nordosten Deutschlands führt. Damit ist das Dreiländereck Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt das Zentrum für die Elitezucht der Lewitzer. Als deren Stammväter kann man Poncho und Salto bezeichnen. Nennt man zudem die Namen Peter I, Grandy, Poseidom, Munser I, Orlando und Olli T, leuchten bei Kennern der Szene garantiert die Augen.
So erklärt sich auch der inzwischen bundesweit über alle Maßen gute Ruf dieser Pferderasse. Auf dem Hof des 71-jährigen Günter Giese in Karenz im Kreis Ludwigslust erblickten bereits 168 Fohlen das Licht der Welt. Ein exzellenter Züchter also. In diesem Jahr gelang ihm sogar das seltene Kunststück, sechs Fohlen von fünf Stuten aufzuziehen. Seine Perle II bekam nämlich ein Zwillingspaar. Gemeinsamer Vater der sechs ist Olli T, der unter Fachleuten überaus hoch geschätzt wird.
Olli T ist ein Orlando-Sohn. Der steht inzwischen auf dem Reiterhof Gerner in Avendorf bei Lauenburg. Geritten wird er vom 10-jährigen Justus Ove, Sohn des Hofinhabers. Bemerkenswert ist, dass der kleine Justus bei 13 E-Springen hintereinander, bei denen er in den vergangenen Wochen und Monaten an den Start ging, mit Orlando ohne einen Abwurf blieb. Wer wollte angesichts dessen nicht davon sprechen, dass die Lewitzer zuverlässig und einsatzfreudig sind?
Aber auch robust, intelligent, wesensstark, energievoll und deshalb nicht zuletzt liebenswert. Justus Ove jedenfalls würde seinen Orlando um keinen Preis wieder hergeben. Und sein Trainer Reiner Klink, der schon im Stall von Olympiasieger Ulli Kirchhoff tätig war, sagt: »So ein Pferd wie ihn habe ich bislang noch nicht erlebt. Ein paar Zentimeter größer, und er wäre zu ganz Großem fähig.«
Ein ähnliches Zeugnis stellt auch Peter Hellwig den Lewitzern aus. Der 50-Jährige, der sein Leben lang mit Rössern zu tun hatte, meint: »Es gibt kein charakterfesteres Pferd. Ich möchte es mit keiner anderen Rasse mehr tauschen.« Letzteres wird der Spezialist auch nicht mehr nötig haben. Er ist nämlich auf dem Hof »Alte Büdnerei« in Techentin bei Ludwigslust tätig. Der wiederum gehört Brigitte Albrecht, die gewissermaßen im Landeszuchtverband Mecklenburg-Vorpommerns den Hut für die Lewitzer auf hat. Unter den Fittichen Peter Hellwigs steht unter anderem der Verbandsprämienhengst Munser I. Ein ausgesprochen schickes Pferd mit viel Ausstrahlung. Aus der Nachzucht des Zwölfjährigen sind zahlreiche prämierte Fohlen hervorgegangen. Sie werden in Züchterkreisen gern und oft genannt.
Einen Schub züchterischen Fortschritts könnte den Gescheckten auch das traditionsreiche Gestüt Redefin bringen. Der Chef des über die bundesweiten Grenzen hinaus bekannten Unternehmens in der so genannten Griesen Gegend, Hans-Thomas Sönnichsen, weilte im vergangenen Sommer in der angestammten Heimat dieser Tiere. Er zeigte sich beeindruckt, mit welcher Begeisterung die Urlauber mit ihren Kindern im idyllisch gelegenen Jagdschloss Friedrichsmoor mit den bunten Rössern ihre Freizeit verbringen und sich erholen. »Auf Dauer«, so Sönnichsen, »könnte in Redefin auch ein Lewitzer Hengst stehen.« Chancen, eine Samenbank im Hengstdepot anzulegen, sehe er durchaus. Und das wäre ein großer Schritt für die weitere Verbreiterung der Rasse – national wie international.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.