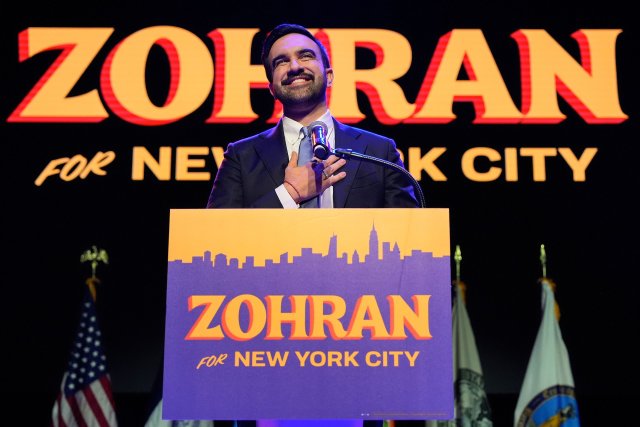Selten hat in den vergangenen Jahren ein Parlamentsbeschluss in Algerien für so viel Wirbel gesorgt. Obwohl die islamistischen Parteien nicht über die Mehrheit in der Nationalversammlung verfügen, setzten sie jetzt ein Gesetz zum Verbot des Imports alkoholischer Getränke durch.
Der überraschende Parlamentsbeschluss hat nicht nur der Öffentlichkeit die hartnäckige Entschlossenheit der Islamisten in Erinnerung gebracht, allmählich einen Gottesstaat zu errichten. Zugleich bereitet er der Regierung ein ernstes Problem mit Algeriens ausländischen Handelspartnern. Ursprünglich wollte die Exekutive lediglich eine Gesetzesänderung über höhere Zölle für Weinimporte absegnen lassen, um der einheimischen Weinproduktion unter die Arme zu greifen, die unter der erschlagenden Konkurrenz aus dem Ausland ächzt.
Doch dann beantragte die Partei El Islah (Die Reform), gleich sämtliche Importe des Teufelszeugs zu verbieten. In ihrer »Überzeugungskampagne« erhielt sie selbstverständlich die Rückendeckung der Abgeordnetenkollegen aus der zweiten islamistischen Partei im Parlament, der Bewegung der Gesellschaft des Friedens (MSP). Denen wird allerdings unterstellt, weniger moralische Gründe als vielmehr die Geschäftsinteressen des größten algerischen Bierherstellers im Hinterkopf gehabt zu haben. Der steht ihrer Partei nämlich ziemlich nahe.
Ungeachtet dessen bearbeiteten die Islamisten die anderen Abgeordneten, vor allem die der größten Fraktion, der FLN, mit Appellen an das religiöse Gewissen. Offenbar unter dem Eindruck des derzeitigen Fastenmonats Ramadan war bei den wenigen zu nächtlicher Stunde anwesenden FLN-Vertretern die Gottesfurcht schließlich so groß, dass sie tatsächlich zustimmten. Bei der Verkündung des Ergebnisses brach in den islamistischen Fraktionen Jubel aus. »Unser Ziel ist es, den Konsum von Alkohol in unserem Lande nach und nach zu verbieten«, erklärte siegesgewiss einer der Abgeordneten.
Dieser Teilsieg ermuntert die Islamisten in ihren Aktionen auch in anderen Bereichen. So stellen sie sich offen gegen die gerade durchgesetzte zaghafte Bildungsreform, durch die der Fremdsprachenunterricht gefördert werden soll. Zudem haben sie eine Kampagne gegen die geplante Änderung des Familiengesetzes gestartet, das die algerische Frau immer noch zu einer Unmündigen auf Lebenszeit degradiert.
So groß wie die Freude auf der einen Seite war, so groß war die Bestürzung bei den anwesenden Vertretern der Exekutive. »Ich weise Sie darauf hin, dass diese Änderung im Gegensatz zu den von Algerien international eingegangenen Verpflichtungen steht«, so die Reaktion des Finanzministers. In dem vor zwei Jahren mit der Europäischen Union vereinbarten Assoziierungsabkommen garantiert das nordafrikanische Land, keinerlei Importverbote zu verhängen. »Wir müssen mit Gegenmaßnahmen unserer Partner, etwa einem Importstopp für algerische Weine, rechnen«, befürchtet er. Zudem gehen dem Land durch den Einfuhrstopp für Wein und Spirituosen nun jährlich etwa 10 Millionen Dollar an Steuereinnahmen verloren.
Auch wenn in der Bevölkerung nur ein kleiner Teil direkt betroffen ist - für die meisten Algerier sind die teuren Getränke ohnehin unerschwinglich -, kann der Schaden doch langfristig schmerzhafte Ausmaße annehmen. Immerhin wurde damit nicht nur dem von Staatschef Abdelaziz Bouteflika (FLN) im Ausland propagierten Bild von einem weltoffenen Algerien ein grober Kratzer verpasst. Fünf Monate vor den Präsidentschaftswahlen fragen sich einige Beobachter sogar, ob nicht sein parteiinterner Rivale für die Kandidatur, Ali Benflis, seine Finger im Spiel hatte. Gelitten hat jedoch vor allem die Glaubwürdigkeit des Landes als berechenbarer Handelspartner. Das dürfte die gerade vor dem Abschluss stehenden Verhandlungen über den Beitritt zur Welthandelsorganisation nicht gerade erleichtern.
Eine letzte Rettung sehen einige Beobachter in einer eventuellen Ablehnung des Gesetzes durch den Senat - dies wäre allerdings das erste Mal, dass ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz nicht bestätigt wird - oder durch ein Dekret des Staatspräsidenten. Sollte das Gesetz tatsächlich ab Januar kommenden Jahres in Kraft treten, werden sich die Islamisten zumindest eines Irrtums bewußt werden: Durch Prohibition wurde bislang noch niemand geläutert. Stattdessen werden Schwarzmarkt und -brennereien Hochzeiten erleben.
»Wahrscheinlich sind sich die Abgeordneten, die für diese ungereimte Entscheidung gestimmt haben, der tatsächlichen Folgen nicht einmal bewusst«, kommentierte die Tageszeitung »El Watan«. Deren Karikaturist legte einem Abgeordneten die Worte in den Mund: »Mir ist das egal. Ich bekomme mein Zeug über ausländische Botschaften.« Ein anderer Abgeordneter schlägt ihm auf die Schulter: »Los, darauf trinken wir einen!«