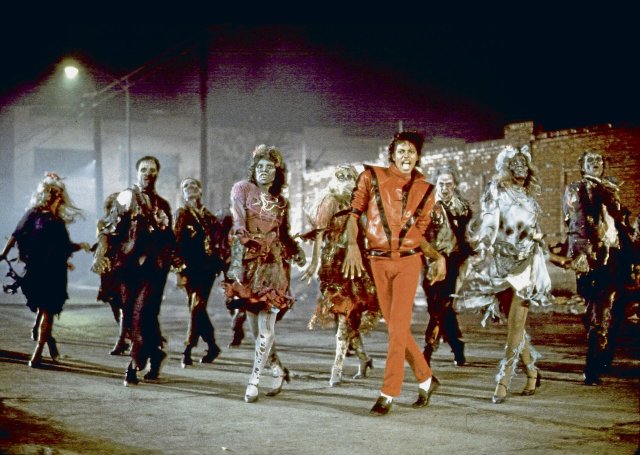Revolution aus dem Salon
»Henriette Herz in Erinnerungen, Briefen und Zeugnissen«, ediert von Rainer Schmitz
Goethe war einfach zur falschen Zeit in Berlin - 1778, als Friedrich der Große gerade wieder mal Krieg führte. Das Militärische aber war dem Freigeist suspekt. Goethe mochte Berlin nicht, dessen Bewohner er als »verwegenen Menschenschlag« empfand. Aber Berlin mochte Goethe. Die preußische Hauptstadt erkor ihn zum klassischen Autor.
Hätte Goethe Henriette Herz kennengelernt, vielleicht wäre seine Meinung von der Stadt eine höhere gewesen. Schon als junge Frau wurde die 1764 geborene Tochter eines jüdischen Arztes, der aus Portugal stammte, verehrt. Karl August Böttiger war beeindruckt von ihren »kolossalischen Vollkommenheiten«. Der Schriftsteller reihte sie unter die »stolzen junonischen Schönheiten«. Sie war größer als die meisten ihres Geschlechts, dabei von einer »gefälligen Fülle der Formen«, mit wachen Augen und langem dunklen Haar, das sie meist offen trug. Im »gesetzlichen Kopfputz« fühlte sie sich unfrei.
Schon für die Zwölfjährige fand ihre Familie eine gute Partie, sie wurde verlobt mit dem 15 Jahre älteren Arzt Marcus Herz, dessen Namen sie nach der Heirat annahm. Die beiden passten äußerlich nicht gut zusammen, Herz war kleiner als seine Frau und unansehnlich. Aber nach innen funktionierte es gut, denn der Gatte war einst Kants Lieblingsschüler und beeindruckte als Denker.
Die Ehe war wohl eine vorzügliche Zweckgemeinschaft. Henriette Herz eröffnete ihren Salon. Alles, was Rang und Namen in dieser Zeit hatte, verkehrte dort. Nie war das intellektuelle Niveau in Preußens Kapitale so hoch. Kunst, Musik und Architektur, Literatur und Philosophie wurden zusammen mit Themen der Zeit erörtert; das glich einer geistigen Revolution aus dem Salon.
Rainer Schmitz hat jetzt in einer lobenswerten Edition Zeugnisse aus den Jahren 1786 (Todesjahr Friedrichs II.) und 1806 zusammengestellt. Sie erzählen von einer produktiven Großstadtkultur, die damals ihresgleichen suchte. Nach Beginn der napoleonischen Kriege wurde sie dezimiert.
Der Salon als Treffpunkt freiheitlicher Geister war auch ein Ort der Geselligkeit. Der Philosoph Moses Mendelssohn hatte damit angefangen, doch »Mad. Herz« erweiterte derartige Zusammenkünfte durch mehr Eleganz und Weltläufigkeit. Aristokraten diskutierten mit Beamten, Gelehrte trafen auf Lebenskünstler, die üblichen gesellschaftlichen Schranken wurden leger überwunden. Kein Gast war unwillkommen: Er war als Fremder ein Gewinn. So kam es, dass Wilhelm von Humboldt, Friedrich Gentz oder Karl Philipp Moritz, eigentlich Konkurrenten, hier friedlich miteinander plauderten. Konfession und Stand, damals noch von Bedeutung, spielten kaum eine Rolle. Der Geist war »ein gewaltiger Gleichmacher«. Ein Gefühl geistigen Aufbruchs beflügelte die Salongäste. Es wurden die aufregenden Bücher (wie Goethes »Werther«) debattiert. Das Theater war wichtig, die schönen Künste.
Das alles hatte mit der Ausstrahlung von Henriette Herz zu tun. Sie muss eine umsichtige und reizende Gastgeberin gewesen sein, beherrschte mehrere Sprachen und galt als blendende Schönheit. Nachdem ihr Mann 1803 verstorben war, gingen von ihr keine erotischen Avancen aus. Friedrich Schleiermacher schrieb ihr, sie sei »sehr schön, aber ich möchte sagen, Du bist zu schön, Du bist zu imponierend und zu wenig pikant, es ist nichts an Dir, was ein bisschen liederlich aussähe, und das ist so notwendig für die Asthenie der Männer«. Die Dame nahm das hin, ihr ging es darum, »das gesellige Leben als ein Kunstwerk zu construiren«.
Ihr Salon war der Aufklärung verschrieben. Die besaß seinerzeit in Berlin einen Standort, der ihre Wirkung wie nirgendwo sonst in deutschen Landen entfaltete.
Henriette Herz in Erinnerungen, Briefen und Zeugnissen. Neu ediert von Rainer Schmitz. Die Andere Bibliothek, 576 S., geb., 40 €.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.