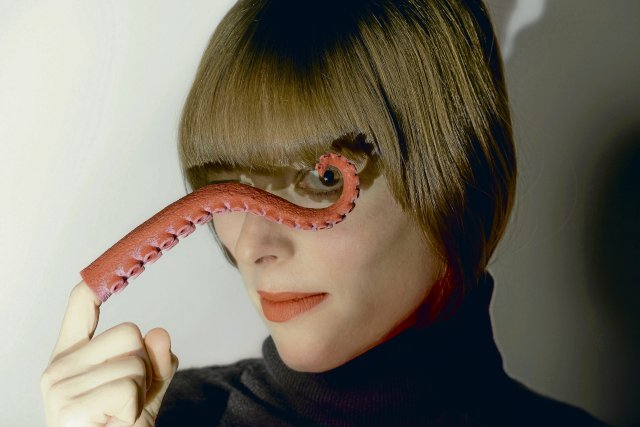Vom Schweigen der Deutschen
Von der »Normannentheorie« bis Wolgograd: Warum niemand vor Russlands Botschaft Blumen niederlegt
Frank Walter Steinmeier hat den Knall dann doch noch gehört. Irgendwann am Montagvormittag tauchte auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes die knappe Nachricht auf, der Außenminister kondoliere seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow im Angesicht der Terrorserie, die am Wochenende in Wolgograd an die 30 Menschen das Leben gekostet hat.
Doch hatte es nach der ersten Bombe über 24 Stunden gedauert, bis Deutschland reagierte. Noch Montag früh gab es beim Berliner Außenministerium keine Stellungnahme zu dem Anschlag, obwohl der seit Sonntag früh in den Medien war. Stattdessen wurde einer symbolischen Attacke auf die Fassade der deutschen Botschaft in Athen gedacht.
Zuletzt im Oktober hatten Terroristen in Wolgograd sieben Menschen ermordet; bereits am Freitag hatten in Pjatigorsk drei weitere ihr Leben verloren, die hierzulande nur eine Randnotiz abgeben. Es klingt so zynisch und beschämend, doch muss an dieser Stelle festgehalten werden: Auch Russen sind Menschen. Sie haben Gefühle. Sie sind nicht weniger wert als Deutsche oder Amerikaner. Und sie sind uns nicht nur geografisch, sondern auch historisch näher als diese.
Warum sind die Deutschen dann so unfähig, Mitgefühl zu entwickeln? Warum legt niemand vor der russischen Botschaft Blumen ab? Warum ist es kein Skandal, wenn »Tagesschau«-Sprecher Jan Hofer die Mordgesellen nicht »Terroristen«, sondern »Rebellen« nennt? Warum stößt sich niemand daran, wenn Hofer verständnisvoll anfügt, dass Russland ja auch eine »gewaltsame Besatzungspolitik im Nordkaukasus« betreibe? Oder daran, dass der WDR-Journalist Hermann Krause in die Trauer der Hinterbliebenen hinein verkündet, der Terror in Russland sei »hausgemacht«? Warum kann im deutschen Radio mit einem gewissen Unterton kommentiert werden, dass die Anschläge letztlich Präsident Wladimir Putin in die Hände spielten? Warum werden die, die Russland mit Massenmord überziehen, hierzulande nicht wenigstens als »feige« und »hinterhältig« charakterisiert – wie bisher noch jeder afghanische »Extremist«, selbst wenn der seine Hand gegen Schwerbewaffnete erhob, nicht gegen Frauen und Kinder?
Diese doppelten Standards sind keine Momentaufnahme. Ähnlich reagierte Deutschland 2010 auf den grausigen Anschlag in der Moskauer U-Bahn, der 40 Leben kostete – oder auf die Attentate auf Moskauer Wohnhäuser, die 1999 etwa 400 Opfer forderten. Damals gefielen sich die deutschen Medien in unbewiesenen Verschwörungstheorien und präsentierten den russischen Geheimdienst als Täter. Das hätte sich mal jemand zwei Jahre später trauen sollen, als es um das World Trade Center ging und eine Welle des Mitgefühls dieses Land erfasste.
Die kollektive deutsche Gefühlskälte gegenüber den Russen kommt nicht von ungefähr. Sie hat Ursachen, die in das 19. Jahrhundert zurückreichen. Damals befanden vor allem deutsche Historiker, dass dem »Slawentum« die sittliche Kompetenz zur Bildung von Gemeinwesen fehle – weswegen in der »Normannentheorie« die Anfänge von Staatlichkeit in Russland auf Wikingerüberfälle zurückgeführt wurden, von denen die passiven Slawen »befruchtet« worden seien. Radikalisiert wurde dieses »Wissen« in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als die Figur des slawischen »Untermenschen« hauptsächlich anhand der Russen entstand – brutal und roh, ungebildet und verschlagen, grausam in der Herrschaft und duckmäuserisch in der Unterwerfung; jemand, der die Knute will und der sie auch verdient. Nicht minder als der Antisemitismus hat dieser Antislawismus den Ideenbrei gewürzt, den Hitler seinen willigen Deutschen kredenzte: Der »Untermensch« rief quasi nach dem Vernichtungskrieg.
Doch anders als der Antisemitismus, der in der Bundesrepublik ab etwa Mitte der 1960er Jahre eine »Aufarbeitung« erfuhr und seither zumindest stark tabuisiert ist, wurde das Untermenschendenken nie wirklich revidiert. In der Frontstellung des Kalten Krieges gelangten die alten russophoben Denkmuster vielmehr sogar zu neuen Ehren – wie auch ihre Träger, jene Hetz- und Mordelite, denen ihre Beteiligung an der Tötung von 15 bis 20 Millionen sowjetischen Zivilisten und je nach Schätzung acht bis elf Millionen sowjetischen Soldaten nunmehr zum Demokratenausweis geriet. Im westdeutschen Antikommunismus, im sich als kulturvoll dünkenden »Widerstand« gegen die »asiatische Tat« (Ernst Nolte) der Revolution, überwinterte zwar nicht das Wort vom »Untermenschen«, wohl aber hielten sich bestimmte Klischeekomplexe bis in die heutige Zeit.
Von der »Unfähigkeit zu Trauern« schrieben 1967 die Sozialpsychologen Alexander und Margarete Mitscherlich und zeigten die kollektiven, unbewussten Mechanismen auf, mittels derer die Deutschen ihre Schuldabwehr organisierten. Nach 1945 habe das Scheitern des einst so heiß geliebten Führers zu einem »›Erwachen‹ aus einem Rausch« und zu einer »traumatischen Entwertung des eigenen Ich-Ideals« geführt, zu deren Abwehr eine »Derealisierung des Geschehenen« nötig geworden sei. Oder, im Fall der Russen, eine perfide Opfermathematik, in der deren vergleichsweise harmlose Besatzungspolitik in Deutschland nachträglich als Begründung für den Angriff herhalten musste. Dem Russen gegenüber fühlt man sich moralisch noch und wieder allemal überlegen.
Dieses Denken ist in Deutschland bis heute nicht nur hoffähig, es ist sogar gewissermaßen eine offizielle Haltung: Kein anderer bedeutender Staat in Europa leistet sich ein Oberhaupt, das in bald zwei Jahren noch nicht einmal einen Höflichkeitsbesuch in Moskau hinbekam.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.