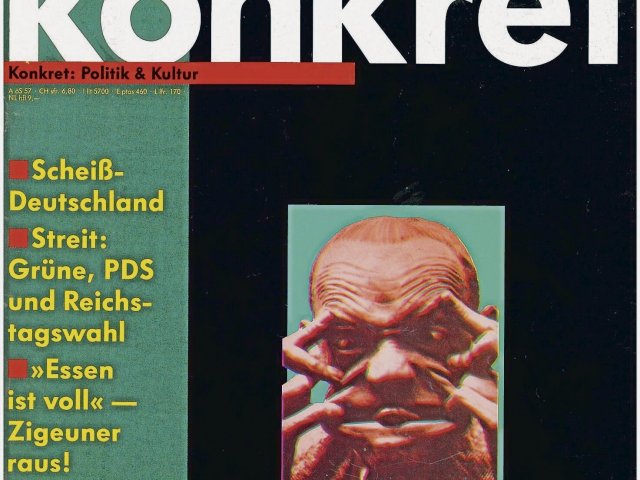Angst vor Menschen
Die Dokumentation »14 Arten, den Regen zu beschreiben« thematisiert den sozialen Rückzug
Es gibt sie überall. Menschen mit Ängsten, die den Kontakt zur Umwelt möglichst gering halten. Menschen, die sich in ihren Räumlichkeiten einschließen. Der Regisseur Marcel Ahrenholz, Jahrgang 1977 und heute in Leipzig lebend, war seit 2007 auf Spurensuche: »Ich fühlte großes Verständnis für den Wunsch, die Außenwelt vor sich wegzuschließen, sich vor den kleinen und großen ›Katastrophen‹ in Sicherheit zu bringen.« Seine dokumentarische Aufarbeitung hätte es aber fast gar nicht gegeben, Ahrenholz erläutert: »Ich hatte durch den ›Phoenix-Förderpreis‹ 2009, durch die Film- und Medienstiftung NRW und durch die Mitteldeutsche Medienförderung schon ein Budget von 125 000 Euro zusammen. Doch niemand von den Betroffenen wollte sich äußern.«
Kurz vor dem Scheitern des Projektes meldete sich die zweifache Mutter Manuela aus Leipzig, die Dreharbeiten konnten im Winter 2010 beginnen. Zu Beginn des Filmes läuft die damals 43-Jährige durch einen Wald und beginnt zu erzählen: »Mein Sohn Peter ist heute 18, und wir haben eine fünfjährige traumatische Odyssee von Klinikaufenthalt zu Klinikaufenthalt hinter uns: Eine Unmenge an Medikationen, die offenbar nicht gut genug gewirkt und oft mehr geschadet als geholfen haben. Mittlerweile sitzt er in seinem Zimmer, verweigert jeden Kontakt und reagiert sogar aggressiv, wenn man ihn anspricht.«
Ahrenholz und der Kameramann Andreas Köhler begleiteten Manuela ein Jahr lang, zumeist vier Tage pro Monat. Im Mittelpunkt steht die betroffene Familie. Im Laufe der Zeit wird sich Manuela von ihrem Mann trennen, während ihrer Arbeit findet die Bibliothekarin eine positive Einsamkeit: Einkehr und Stille. Der Sohn Peter ist selbst nie im Bild, nur benutztes Geschirr, Wäsche im Badezimmer und die sichtbaren Spuren auf der Seele seiner Mutter bezeugen seine Existenz.
Tagsüber schläft er zumeist, nachts ist er wach. Die Tragödie seiner stummen Verweigerung wird an Manuela veranschaulicht. Sie liest die Arztprotokolle und Gerichtsbeschlüsse vor, sie schwankt zwischen Hoffnung und Ratlosigkeit, sie steht auf dem Balkon und raucht verstohlen Zigaretten, während ihr Blick in der Ferne Kategorien sucht: Was ist normal? Wie viele Diagnosen von den unterschiedlichsten Ärzten gibt es noch? Wie kann man einer paranoiden Schizophrenie, den wahnhaften Depressionen und den schizoaffektiven Störungen begegnen?
Dem Film gelingt eine schwierige Gratwanderung; an einer Erklärung der Krankheit oder an einer Ursachenforschung beteiligt er sich nicht. Stattdessen wird das filmische Tagebuch eines Kampfes um Normalität durch sensible, künstlerische Momente bereichert. Es sind die Naturbilder von düsteren Wolken, von einsamen Bäumen und gemeinsam im Wind wehenden Getreideähren, die neben der bedrückenden Klaviermusik von Emil Klotzsch die Grundthematiken metaphorisch unterstreichen.
Mit Blick auf seine Recherche verrät Ahrenholz: »Das Zu-Hause-Bleiben-Wollen ist keine Krankheit. Es ist ein Symptom und gehört zu verschiedenen Krankheiten.« Ängste vor Mobbing, vor dem Leistungsdruck und Sozialphobien seien aber fast immer vorzufinden. Während der Dreharbeiten, die im Winter 2011 abgeschlossen wurden, entstanden Freundschaften. Damals musste sich das Filmteam immer wieder einen distanzierten Status erarbeiten, zu nah gingen die Geschehnisse. Heute trifft man sich noch regelmäßig, die grundlegende Situation hat sich nicht verändert. Peters vier Wände seien noch immer »eine Grenze, die schwer zu überwinden ist.«
Nachdem die Dokumentation in den letzten Jahren in einigen Kinos zu sehen war, wird sie jetzt erstmals im Fernsehen ausgestrahlt. Das Fazit, das am Ende nackte Statistiken beschließen, ist aktueller denn je: »Die Patienten in den Kinder- und Jugendpsychiatrien werden immer jünger.«
Phoenix, 17.1., 22.30 Uhr; www.14artendenregenzubeschreiben.de.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.