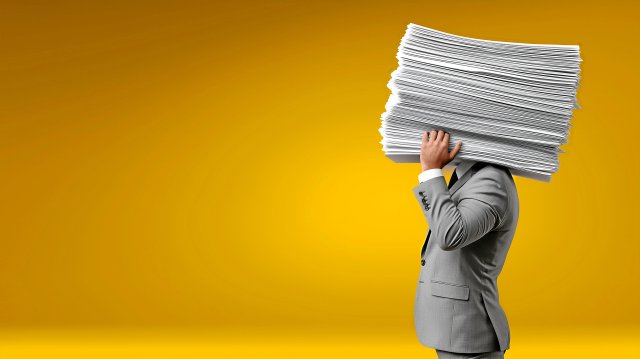Russisches Roulette in der Tüte
Simon Poelchau über Bestrebungen der Bundesregierung, den Handel mit sogenannten Legal Highs strenger zu verfolgen
Früher nahm die Jugend noch richtige Drogen: Sie rauchte Gras, schluckte Ecstasy-Pillen und schnupfte Speed. Heute greift sie zu sogenannten Legal Highs, weil diese vor allem einfacher zu haben sind. Die Bundesregierung plant nun, diese Designerdrogen mit mehr Verboten einzudämmen.
In der Tat sind die gepanschten Mittelchen etwa in England mittlerweile fast ein größeres Problem als konventionelle Drogen. Denn die Legal Highs werden von ihren Erfindern aus purem Gewinnstreben entwickelt. Sie mischen Substanzen zusammen, die niemand kennt und deren Nebenwirkungen niemand abschätzen kann, und verkaufen sie solange legal als angebliche Badezusätze oder Duftkistchen, bis sie früher oder später als illegale Substanzen verboten werden. Bei »Spice«, dem in Deutschland wohl bekanntesten Legal High, tauschten die Konsumenten so die zwar auch nicht ganz unproblematische, aber seit Jahrtausenden bekannte Kulturdroge Cannabis gegen ein Russisches Roulette in der Tüte aus.
Doch Verbote lösen das Problem nicht. Denn eine Gesellschaft ohne Drogen wird es nie geben. Das Einzige, was man sicherstellen kann, ist, dass die Leute sich keinen Dreck reinziehen. Da sind die Legalisierung des Altbewährten und bessere Aufklärung wohl der sinnvollere Weg.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.