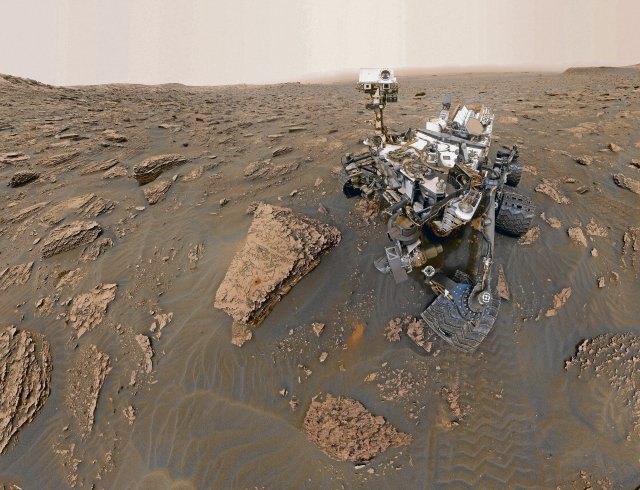»Hinhören und das Maul aufmachen«
Birgit Vanderbeke muss sich von einem Kindheitsschrecken befreien
Die Erzählung »Das Muschelessen«, 1990 ausgezeichnet mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, hat sie berühmt gemacht. Der naiv plappernde Tonfall, hinter dem sich Zorn verbirgt, Bitterkeit auch - Birgit Vanderbeke brachte einen ganz eigenen Stil in die deutsche Literatur, auf dessen Wirkung sie sich verlassen kann. Der neue Roman scheint einen Bogen zu schlagen zu diesem literarischen Beginn. Wieder die Familie, die wir schon kennen, nur dass die Tochter viel jünger ist. Sie feiert ihren siebenten Geburtstag, hätte sich sehnlichst eine Katze gewünscht, die sie natürlich nicht bekommt, und erlebt wieder einmal, wie die Erwachsenen lügen. »Wir freuen uns, dass du geboren bist«, singt die Mutter mit piepsiger Stimme. Der Vater hätte lieber einen blonden Jungen gehabt und meint sowieso, dass er mit der Familie seine Jugend »verplempert«. Die Mutter denkt immer noch an das reiche Leben, das ihr jener Gutsbesitzersohn versprochen hat, der leider im Krieg gefallen ist. Und das kleine Mädchen überlegt, dass sie dann gar nicht auf die Welt gekommen wäre.
Es ist, wie so oft, wenn die Träume der Erwachsenen auseinanderdriften und das Kind eigentlich nur stört. Nur dass es hier zur Gewalt eskaliert. »Das Muschelessen« war kunstvoll entlarvend, aber der neue Roman ist in einem noch stärkeren Maße bitter-ernst. Im Grunde bekennt die Autorin: Ich war ein misshandeltes Kind. Für diese Aussage hat sie Zeit gebraucht.
Bei Wikipedia steht, »Das Muschelessen« handele in der Endzeit der DDR und sei eine Parabel auf das Duckmäusertum, das dort herrschte. Blödsinn! Es passte wohl in die Vorstellungswelt des unbekannten Wikipedia-Autors, »die aufbrechende Unzufriedenheit« in der Familie »als Zeichen für die wachsende Opposition in der DDR« zu deuten. Dabei ist schon zu Beginn davon die Rede, dass der große Emailletopf, in dem die Muscheln gekocht werden, zu den Sachen gehörte, die nach Westberlin »hinübergeschafft« wurden. »Wir sind doch nicht Hals über Kopf getürmt«, erklärt die Mutter, »das war doch von langer Hand vorbereitet.«
Hier nun die autobiographisch fundierte Vorgeschichte: das Weggehen von der Großmutter in der Nacht, ohne Abschied - sie würden einander wohl nicht wiedersehen, meinte die Mutter -, die Zeit im Flüchtlingslager, wo das Kind bei fremden Leuten eine Zuwendung fand, die es später vermisste. Als sie dann eine Neubauwohnung im »Land der Verheißung« bekamen - die sarkastische Wortverbindung taucht mehrmals im Roman auf -, kauften sich die Eltern Teakholzmöbel fürs Wohnzimmer, Kühlschrank, Waschmaschine, Elektroherd und andere »wertvolle Sachen«. Aber sie waren nicht zufrieden, es war alles noch falsch oder nicht genug. Und als der Vater aufstieg in der Betriebshierarchie (der Preis dafür war hoch) und sie in eine schönere Wohnung zogen, wurde alles fast nur noch schlimmer.
»Warum sie überhaupt abgehauen waren«, fragt sich das Kind, das lieber bei der Oma geblieben wäre. Und unsereins fragt sich beim Lesen, ob das Geschilderte auch in der DDR hätte passieren können. Womöglich ja. Hätte sich auch dort ein Arzt gefunden, der die Misshandlung vertuscht hätte? Aber darum geht es der Autorin nicht. Wovon sie erzählen will, das ist ihre »beste Idee«, die sie eben mit sieben Jahren hatte, als ihr Tante Eka, Onkel Winkelmann und Onkel Grewatsch, die im Flüchtlingslager zusammenwohnten, das Buch »Die Zeitmaschine« schickten. Eine Schneekugel hatte sie von ihnen vorher schon bekommen. Aber sollen wir jubeln, wie sie sich, vom Vater zerschlagen, zur inneren Flucht entschließt? Eine Siebenjährige, die fortan durch die Kraft ihrer Phantasie in sich eine »eigene, tiefe Stimme« findet, die mal lacht und flunkert und dann sogar den Mut fasst, dem Vater Ungeheuerliches ins Gesicht zu sagen. Oder gelang ihr das nur, weil sie eine Zeitreise ins Später unternommen hatte? War es eine notwendige Abrechnung von heute aus?
Onkel Winkelmann hatte ihr die Geschichte von den drei feigen Affen erzählt. »Genau hinschauen, hörst du? Egal, was sie dir erzählen. Hinhören und das Maul aufmachen. Der Welt wäre was erspart geblieben.« Getreu dieser Maxime hat Birgit Vanderbeke ihre Bücher geschrieben: scharfsinnige Zeitanalysen. Vorliegender Roman ist gut und war wohl notwendig für sie, doch wünsche ich mir, dass sie wieder in der für viele so verwirrenden Gegenwart mit ihren scheint’s unlösbaren Problemen ankäme. Denn sie hat das Zeug, die Dinge besser als andere zu durchschauen.
Birgit Vanderbeke: Ich freue mich, dass ich geboren bin. Roman. Piper Verlag. 154 S., geb., 18 €.

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.