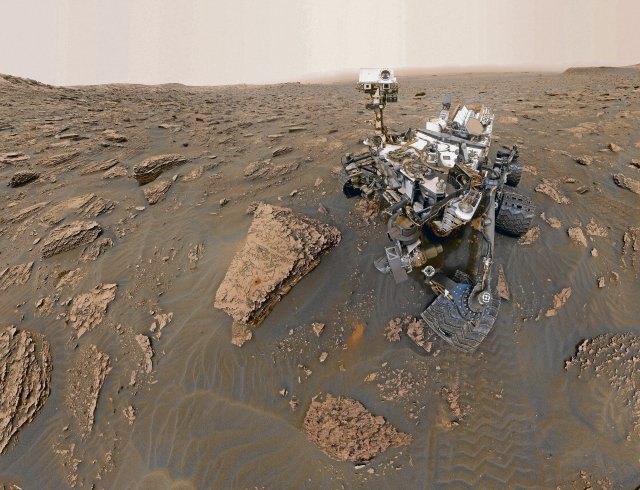Die letzte verpasste Chance
Wer in Deutschland stirbt, wird meist so schnell wie möglich weggeschafft. Damit nehmen sich Angehörige die Chance des Abschieds, vor allem den Kindern
Vaters Tod kam nicht überraschend. Er war länger schwer krank gewesen. Wir hatten das Krankenbett auf seinen Wunsch ins Wohnzimmer gebracht, wo er Besuch empfangen konnte. Und genau dort starb er schließlich am frühen Abend. Wir behielten ihn zu Hause, eine Nacht und einen Tag lang. Es kamen viele Besucher, es gab Kaffee und Kuchen - direkt am Sterbebett, direkt neben dem Leichnam. Viele fanden die Situation ungewohnt, keiner fand sie beängstigend oder gar unerträglich. Alle, die den Sterbenden häufiger besucht hatten, fanden nun den Anblick des Toten tröstlich.
Einen Verstorbenen zu Hause aufbahren zu lassen, ist einfach. Zunächst stellen Hausarzt oder hausärztlicher Notdienst einen Totenschein aus. Das Aufbahren selbst ist nichts weiter, als den Verstorbenen zu waschen, zu rasieren, zu kämmen und ihm eine persönliche Kleidung anzuziehen. Das übernimmt etwa der Pflegedienst, der bei Schwerkranken zumeist sowieso schon seit Wochen oder Monaten ins Haus kommt. »Wir machen das in fast allen Fällen. Auch für uns ist das eine Möglichkeit, uns von einem unserer Patienten würdig zu verabschieden«, sagt Hannelore Michels, Chefin der »Pflegenden Hände« in Castrop-Rauxel. Nach der Aufbahrung sieht der Verstorbene zumeist friedlicher aus als der Sterbende zuvor: Magensonde, Sauerstoffgerät oder Infusion sind weg. Der Kampf ist vorbei. Jetzt wäre Zeit für einen entspannten Abschied. In vertrauter Umgebung. Mit Freunden und Verwandten. Ohne Eile. Was auch das Gesetz erlaubt: In den meisten Bundesländern ist eine Aufbahrung zu Hause bis zu 36 Stunden erlaubt (Sachsen und Brandenburg erlauben nur 24 Stunden, Thüringen 48, Bayern nennt keine Frist). In dieser Zeit darf der Verstorbene zu Hause bleiben - in Bett oder Sarg, offen oder geschlossen.
Aber genau das passiert fast nie. »Viele Angehörige wollen den Verstorbenen so schnell wie möglich aus dem Haus haben«, sagt Martin Hellfeier, Bestatter aus Castrop-Rauxel und spricht sogar von einer Entsorgungsmentalität. »Holen Sie ihn einfach ab!« heiße es nicht selten. Manche empfinden schon die wenigen Stunden, bis sie den Totenschein in Händen halten, als unzumutbar. Die Hektik hat viele Gründe: Manche haben Angst vor den Veränderungen des Toten, vor Verwesung oder gefährlichen Giften. Aber diese Angst ist medizinisch unbegründet: »Wenn ein Kranker eine bedrohliche Infektion hatte, dann war diese auch schon vor seinem Tod gefährlich - mit dem Eintritt des Todes ändert sich das nicht«, sagt Wolfgang Scherbeck, Palliativmediziner aus Castrop-Rauxel. Alle anderen Leichen sind ungefährlich. Aber die Ängste sind zumeist auch eher diffus: »Viele Menschen wollen einfach nicht mit einem Toten zusammen in einer Wohnung sein. Der Tod ist noch immer ein Tabu«, sagt Scherbeck.
Oft heißt es, Kinder könnten den Anblick eines Toten nicht ertragen. Aber das stimmt nicht. »Es ist die Angst der Erwachsenen vor dem Tod, die auf die Kinder projiziert wird«, sagt Birgit Halbe, Kindertrauerbegleiterin vom Kinder- und Jugendhospiz Balthasar im sauerländischen Olpe. Sie habe überhaupt noch nie negative Erfahrungen mit Kindern gemacht, die aufgebahrte Freunde oder sogar Geschwister besuchten - schon Dreijährige hätten das sehr positiv gefunden. Natürlich müssen Kinder vorbereitet und begleitet werden: »Wir sagen ihnen, wie sich die Verstorbenen anfühlen und wie sie aussehen - und die Kinder testen das und fassen den Toten ohne Scheu an«, so Halbe. Was den Abschied für die Kinder leichter macht.
Auch wir haben es so erlebt: Die Zwillinge Eric und Bent, jeweils fünf Jahre alt, hatten den schwer kranken Großonkel mehrfach vorher besucht. Und genau deshalb sollten sie auch den Verstorbenen sehen: »Sie sollten begreifen, zu welchem Ende die lange Krankheit geführt hat«, sagt ihre Mutter Marion Franke. Für die Kinder war der Tote ausdrücklich kein schrecklicher Anblick: »Er sah auch schön aus, als er tot war«, sagte einer. Hatten sie danach Albträume? Ausdrücklich nicht. Im Gegenteil, sie können sich bis heute ohne Angst an den Tag erinnern und reden über den toten Großonkel.
Diese Chance wird zumeist vertan: »Von etwa 500 Bestattungen im letzten Jahr haben die Angehörigen in genau drei Fällen den Wunsch geäußert, den Verstorbenen zunächst in der eigenen Wohnung zu behalten«, sagt Marina Hausmann, Bestatterin aus Essen. »Die meisten wollen den Verstorbenen so schnell wie möglich aus dem Haus haben.« Viele wissen gar nicht, dass es überhaupt möglich wäre, ihren Verstorbenen zu Hause zu behalten. Den schnellen Weg aus dem Sterbebett in die Leichenhalle hält Hausmann für bedauerlich: »Der Anblick des Verstorbenen ist meist äußerst friedlich. Er kämpft nicht mehr, er schnappt nicht nach Luft. Er ruht. Und um diesen Anblick berauben sich die Angehörigen, wenn sie den Leichnam sofort abholen lassen.« Dabei ginge es sogar umgekehrt: Man kann im Krankenhaus Verstorbene nach Hause holen lassen, um sie dort aufzubahren, und um sich in Ruhe zu verabschieden.
Bei der Aufbahrung in einer klassischen Leichenhalle ist das kaum möglich. Verschlossene Leichenzellen mit Sichtfenster nehmen den letzten Rest von Vertrautheit oder Intimität. Wer seinem Angehörigen etwa noch etwas Persönliches in den Sarg legen will, wer dessen Hand berühren will, wer einfach nur am Sarg stehen will, hat dazu keine Möglichkeit mehr. Allerdings gibt es Alternativen: »Moderne Abschiedsräume kann man betreten, man kann dort sitzen, man kann mit den Händen begreifen, was passiert ist«, sagt Marina Hausmann. Sie bieten einen Kompromiss zwischen der Aufbahrung zu Hause und der technischen Zurschaustellung in einer Leichenkammer mit Guckfenster. Es lohnt sich, den Bestatter zu fragen, welcher Friedhof welche Abschiedsräume hat. Denn die Aufbahrung muss nicht zwingend dort stattfinden, wo später die Beisetzung erfolgt.
In unserem Fall hatte die Aufbahrung zu Hause ein Vorbild bei einem Freund in Polen: Er war ebenfalls zu Hause gestorben und wurde im Sarg im Wohnzimmer aufgebahrt. Drei Tage lang. In der Zeit traf man sich in seinem Haus, man sprach über den Verstorbenen - unmittelbar neben seinem offenen Sarg. Am Tag der Beerdigung verabschiedeten sich Verwandte und Freunde mit einem Kuss.
Diese Art des Abschieds entspricht auch unserem Brauch. »Aber vor etwa 200 Jahren kippte die Tradition der häuslichen Aufbahrung: Die Menschen zogen in die Städte, die Arbeiterwohnungen waren klein, die Totenwache durch die nun oft unbekannten Nachbarn fiel weg«, sagt Dagmar Hänel, Ritualforscherin und Leiterin der Volkskunde im Landschaftsverband Rheinland. »Anfangs wollten die Menschen von Leichenhallen und Feuerbestattung nichts wissen, dann veränderte sich die Kultur drastisch.«

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.