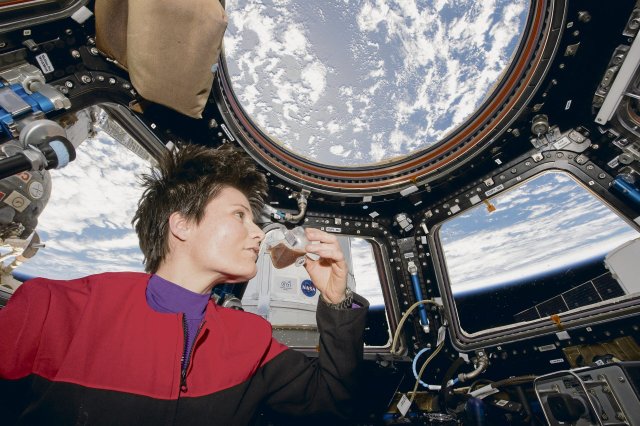»Die Welt ist ein Kunstwerk«
Können ästhetische Prinzipien als Leitfaden bei der Suche nach Naturgesetzen und naturwissenschaftlichen Theorien dienen? Von Martin Koch
Von dem britischen Physiker und Schriftsteller Charles Percy Snow stammt die oft kolportierte These, dass zwischen den Kulturen der Natur- und Geisteswissenschaftler ein unüberbrückbarer Gegensatz bestehe. Die intellektuellen Welten beider Kulturen lägen so weit auseinander, meinte Snow, dass eine gegenseitige Verständigung im Grunde nicht möglich sei.
Dieses Urteil beeinflusst seither auch die Diskussion um schulische Bildungsinhalte. Zweifelhafte Berühmtheit erlangte hierbei der Versuch des Literaturwissenschaftlers Dietrich Schwanitz, all das in einem Buch zusammenzufassen, was unverzichtbar zur Bildung gehört. Nämlich: Literatur, Geschichte, Philosophie, Kunst. Die Naturwissenschaften kommen nur am Rande vor. Originalton Schwanitz: »Naturwissenschaftliche Kenntnisse müssen zwar nicht versteckt werden, aber zur Bildung gehören sie nicht.« Das heißt, wer trefflich über Thomas Manns »Der Zauberberg« oder »Die zerrinnende Zeit« von Salvador Dalí zu parlieren weiß, gilt als gebildet, selbst wenn er zugibt, keinen Schimmer von der Relativitätstheorie oder dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu haben.
Indes genügt ein Blick in die Geschichte, um zu erkennen, dass zwischen Naturwissenschaft und Kunst nicht immer eine Kluft bestand. Im Gegenteil. Bedeutende Künstler wie Leonardo da Vinci und Johann Wolfgang von Goethe waren überzeugt, im Ästhetischen ein verbindendes Glied zwischen beiden Sphären des Geistes gefunden zu haben. »Das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben«, schrieb Goethe. Und auch in der Romantik waren Poesie, Wissenschaft und Philosophie untrennbar miteinander verflochten.
Teilweise zumindest hat sich diese Tradition erhalten. Denn nicht nur Künstler, auch Naturforscher reklamieren für sich einen besonderen Sinn für das Schöne, der vor allem in ihrer Vorliebe für spezielle stilistische Merkmale von Gesetzen und Theorien zum Ausdruck kommt: Einfachheit, Ordnung, Symmetrie, mathematische Eleganz. Der britische Physiknobelpreisträger Paul Adrien Maurice Dirac war sogar überzeugt, dass »eine mathematisch schöne Theorie eher richtig ist als eine hässliche, die mit gewissen Versuchsergebnissen übereinstimmt«. Albert Einstein dachte ähnlich. Im Erstaunen über die »tiefste Vernunft und leuchtendste Schönheit« des Kosmos lag für ihn der Ursprung wahrer Religiosität. Die Vorstellung von einem persönlichen Gott, dem es um die Schicksale von Menschen zu tun ist, lehnte Einstein hingegen ab und bezeichnete den Glauben daran gelegentlich als »kindisch«.
In seinem mit beeindruckender Sachkenntnis verfassten Buch »Die Harmonie des Universums« schildert der Berliner Astronom und Wissenschaftshistoriker Dieter B. Herrmann die vielfältigen Bemühungen von Forschern und Gelehrten, ein rational wie ästhetisch anspruchsvolles Bild der Welt zu entwerfen. Die Ursprünge dieser Entwicklung reichen zurück bis in die griechische Antike. An erster Stelle wäre hier Pythagoras zu nennen, der vor rund 2500 Jahren im süditalienischen Kroton einen Geheimbund gründete, dessen Mitglieder in der Zahl das wahre Wesen aller Dinge erblickten und die glaubten, Gott habe das Universum nach arithmetischen Harmonien geordnet. Als Pythagoras das Verhalten schwingender Saiten untersuchte, bemerkte er, dass der Oktave das ganzzahlige Längenverhältnis von 2:1 zugrunde liegt. Für die Quinte fand er das Verhältnis 3:2, für die Quarte 4:3. Zahlenverhältnisse kannte man seit den Babyloniern auch für das Geschehen am Himmel. Pythagoras war deshalb überzeugt, dass durch die Bewegung der Planeten und der durchsichtigen Sphären, an denen diese angeblich befestigt waren, Töne erzeugt würden. Bei Gelegenheit zog er sich in die Einsamkeit zurück, um dieser »Sphärenmusik« zu lauschen, die der Legende nach nur er hören konnte.
»Das sogenannte pythagoreische Weltverständnis hat eine enorme und die Zeiten überdauernde Ausstrahlung erreicht«, schreibt Herrmann. Faktisch legte Pythagoras den Grundstein für eines der erfolgreichsten Unternehmen der Wissenschaft: die Mathematisierung der Welt. »Ist es nicht überwältigend«, fragte der Physiker und Nobelpreisträger Frank Wilczek bei einem 2015 geführten »Spiegel«-Interview, »dass die Gleichungen, die Atome beschreiben, denjenigen für den Klang von Musikinstrumenten ähneln?« Das könne Zufall sein. Doch wenn es Zufall sei, dann ein wunderschöner, ein Geschenk, meinte Wilczek und fügte an anderer Stelle hinzu: »Die Welt ist ein Kunstwerk«, das vor allem durch seine innere Symmetrie besteche.
Naturforscher, die von der Schönheit von Gesetzen und Theorien sprechen, haben in der Tat zumeist deren Symmetrie vor Augen. Asymmetrie hingegen gilt vielen als unschön, als Makel. Für Einstein zum Beispiel war es in höchstem Maße verstörend, dass nach klassischer Lesart die elektrodynamische Wechselwirkung zwischen einem Magneten und einem Leiter davon abhing, ob der eine oder andere Körper sich bewegt. Die Aufhebung dieser Asymmetrie führte ihn zur Relativitätstheorie, deren Gesetze von Physikern gern als elegant bezeichnet werden. Ähnlich wie die Maxwellschen Gleichungen des Elektromagnetismus, von deren Ästhetik der Physiker Ludwig Boltzmann so verzückt war, dass er in Anlehnung an Faust fragte: »War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb?«
Schönheit liegt im Auge des Betrachters, heißt es gemeinhin. Das trifft auf die Kunst ebenso zu wie auf die Naturwissenschaften. Will sagen: Jemand, der keine intime Kenntnis von den Gegenständen der Physik hat, wird kaum dahin kommen, eine Gleichung als schön zu empfinden. Er nimmt lediglich eine komplizierte mathematische Symbolik wahr. So wie Menschen, die nichts für moderne Kunst übrig haben, auf Bildern von Klee oder Kandinsky nur belanglose Farbmuster erblicken.
Ohne Zweifel hat sich die Idee der Symmetrie als heuristisches Prinzip in der Geschichte der Naturforschung bewährt. Mitunter jedoch führte sie Wissenschaftler auch in die Irre. So behinderte die Annahme, dass alle Planeten sich auf perfekt symmetrischen Kreisbahnen bewegen, lange den astronomischen Fortschritt. Selbst Kopernikus rückte von dieser Vorstellung nicht ab. Erst Johannes Kepler entdeckte die Ellipsenform der Planetenbahnen. Zuvor noch hatte er angenommen, dass zwischen den Bahnen der Planeten und den fünf Platonischen Körpern, die sich symmetrisch aus regelmäßigen Vielecken (Dreieck, Quadrat, Fünfeck) zusammensetzen, ein innerer Zusammenhang besteht.
In einem Werk mit dem bezeichnenden Titel »Mysterium Cosmographicum« (Das Weltgeheimnis) entwickelte Kepler 1596 die These, dass die Abstände der sechs damals bekannten Planeten von der Sonne durch Kugeln innerhalb der fünf Platonischen Körper gegeben seien. Doch dieses elegant anmutende geometrische Modell scheiterte an der Wirklichkeit und war spätestens nach der Entdeckung weiterer Planeten, für die es keine Platonischen Körper mehr gab, nur noch von historischem Interesse. Nicht zuletzt belastete der Mystizismus Keplers auch dessen Verhältnis zu Galilei, der bei seinen Forschungen nie nach Harmonien im Universum gesucht habe, wie Herrmann betont. »Für ihn zählten einzig die Beobachtungsergebnisse.« Auch an den drei Keplerschen Gesetzen sei Galilei nicht interessiert gewesen. Stattdessen hielt er an kreisförmigen Planetenbahnen fest, die nach seiner Meinung als einzige keiner bewegenden Kraft bedurften.
Wo die empirische Beweislage dünn ist, namentlich bei den großen allumfassenden Theorien, versuchen Wissenschaftler häufig, diese Lücke durch gewagte Spekulationen zu schließen. Wie bei der Suche nach der berühmt-berüchtigten Weltformel. Sollte es eine solche tatsächlich geben, sagte der Physiker und Nobelpreisträger Steven Weinberg einmal, würde man sie an ihrer Schönheit erkennen. Andere Physiker sind da etwas bescheidener. Ihnen genügt zur Orientierung das Symmetrieprinzip, das insbesondere bei der Erforschung der Mikrowelt eine wichtige Rolle spielt.
Doch so fundamental dieses Prinzip auch ist, es waren letztlich Brüche der Symmetrie, die eine Entwicklung im Universum überhaupt erst ermöglichten. Wären zum Beispiel nach dem Urknall exakt so viele Teilchen wie Antiteilchen übrig geblieben, hätten sich infolge der gegenseitigen »Vernichtung« aller Teilchen keine materiellen Strukturen herausbilden können. Vielmehr wäre das gesamte Universum mit Strahlung erfüllt.
Derzeit liefert das sogenannte Standardmodell der Elementarteilchenphysik die beste Beschreibung des Verhaltens und der Wechselwirkung subatomarer Teilchen. Gleichwohl sind viele Physiker damit unzufrieden, manche vielleicht auch aus ästhetischen Gründen. Denn das Modell enthält mindestens 18 freie Parameter, die nur anhand von Experimenten festgelegt werden können. Außerdem wird darin die Gravitation nicht berücksichtigt. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass das Standardmodell lediglich Teil einer umfassenderen, weniger willkürlichen Theorie ist, in der die fundamentalen Kräfte der Natur vollständig vereinigt sind.
Um dorthin zu gelangen, bedarf es einer weiteren Symmetrie-Annahme, mit der zugleich die größtmögliche Symmetrie der Natur erreicht wäre. Die neue Theorie hat deshalb die Bezeichnung »Supersymmetrie« (SUSY) erhalten und ist dadurch gekennzeichnet, dass sie jedem bekannten Teilchen ein superschweres Partnerteilchen zuordnet. Damit Supersymmetrie jedoch einsetzt, sind immense Energien von schätzungsweise tausend Gigaelektronenvolt und mehr vonnöten. Das macht die experimentelle Bestätigung der Theorie so schwierig. An keinem der laufenden Beschleuniger konnte bisher eines der schweren supersymmetrischen Teilchen nachgewiesen werden. Bei Physikern wächst deshalb die Ungeduld, zumal es möglich ist, dass sich unter den supersymmetrischen Teilchen auch eine Komponente der geheimnisvollen Dunklen Materie befindet. Ein Grund zur Resignation besteht indes nicht. Noch sei alles offen, meint Herrmann. Noch vertrauten viele Physiker auf die Macht der Symmetrie sowie ihr eigenes experimentelles Können zum Nachweis dieser grundlegenden Eigenschaft der Natur.
Dieter B. Herrmann: Die Harmonie des Universums. Von der rätselhaften Schönheit der Naturgesetze. Kosmos-Verlag, 253 S., 19,99 €
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.