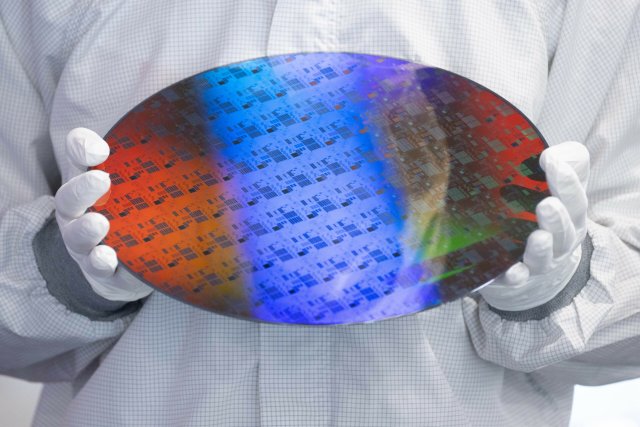Neue Chance gegen Fusion
Wachsender Widerstand in Frankreich gegen Zusammenschluss von Siemens mit Alstom
Ein Gerichtsverfahren gegen den französischen Staat könnte die Übernahme der Lok- und Waggonbausparte des Alstom-Konzerns durch Siemens Mobility in Frage stellen. Die Regierung habe bei den Verhandlungen im Herbst vergangenen Jahres leichtfertig und auf Kosten der Steuerzahler auf mehrere hundert Millionen Euro verzichtet, so der Vorwurf der Kläger.
Die Anti-Korruptions-Organisation Anticor hat deshalb Anzeige gegen unbekannt wegen fahrlässiger Veruntreuung öffentlicher Gelder erstattet. Der Regierung wird vorgeworfen, dass sie auf ihren Anteil von 20 Prozent der Alstom-Anteile verzichtet hat und damit auf mindestens 350 Millionen Euro an Dividenden und Prämien im Zusammenhang mit der Wertsteigerung nach den Meldungen über die Fusion.
Die Vorgeschichte der Affäre reicht bis ins Jahr 2014 zurück, als der damalige sozialistische Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg im Zusammenhang mit dem Verkauf der Energiesparte von Alstom an den US-Konzern General Electric den Baukonzern Bouygues mit der Androhung einer Verstaatlichung von Alstom gezwungen hat, dem Staat zwei Drittel seiner Alstom-Anteile abzutreten.
Da die Regierung zu diesem Zeitpunkt nicht über die dafür nötigen 1,1 Milliarden Euro verfügte, musste Bouygues diese Summe dem Staat in Form eines Darlehens stunden und ihm ein Vorkaufsrecht für die »geborgten« Aktien einräumen. Diese Kaufoption lief Mitte Oktober 2017 fast zeitgleich mit den Fusionsverhandlungen zwischen Alstom und Siemens aus. Hätte die Regierung zu diesem Zeitpunkt von ihrem Vorkaufrecht Gebrauch gemacht, hätte sie für jede dieser 43,82 Millionen Alstom-Aktien nur 30 Euro zahlen müssen. Doch Macrons Wirtschaftsminister Bruno Le Maire verzichtete und ließ die Option verfallen. In einer Parlamentsanhörung erklärte er später, Siemens habe zur Bedingung gemacht, dass sich der französische Staat aus dem neuen deutsch-französischen Konzern heraushält. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Fusionsverhandlungen, stieg der Kurs der Alstom-Aktien sofort auf 36 Euro und anschließend noch höher und der Gewinn, den der Bouygues-Konzern dadurch bis heute gemacht hat, wird von Experten auf mindestens 500 Millionen Euro geschätzt.
Diese neue Wendung verleiht den Gegnern der Fusion neue Hoffnung. Der Widerstand resultiert aus den nicht gehaltenen Zusagen von General Electric hinsichtlich des Erhalts der Arbeitsplätze und den Befürchtungen, dass die neue Fusion nicht wie behauptet eine Zusammenschluss unter gleichberechtigten Partnern ist, sondern dass der Siemens-Konzern, der finanziell angeschlagen die Verhandlungen aufnahm, als Sieger daraus hervorgeht. Die deutsche Seite wird mehr Anteile halten und mehr Sitze im Aufsichtsrat haben als die französische, betonen die Kritiker, und dass Paris zum offiziellen Sitz des neuen Unternehmens erklärt wurde, ändere nichts an dieser Dominanz.
Die vier im Alstom-Betriebsrat vertretenen Gewerkschaften CFDT, CGT, FO und CFE-CGC haben am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung die Fusion erneut entschieden abgelehnt. Sie sei weder notwendig, weil Alstom finanziell solider dastehe als Siemens, noch sinnvoll, sondern mit »großen wirtschaftlichen, industriellen und sozialen Risiken verbunden«, betonen die Gewerkschaften.
Diese Position wollen sie auch entschieden vertreten, wenn zu Wochenbeginn der europäische und Mitte Februar der französische Betriebsrat von Alstom zur Fusion angehört werden. Die Beschäftigten fürchten um ihre Arbeitsplätze, zumal sie mit General Electric bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben. Siemens hat sich im Fusionsvertrag zwar verpflichtet, die Arbeitsplätze in Frankreich vier Jahre lang nicht anzutasten, doch »danach ist eine neue Zerstückelung des Unternehmens durchaus vorstellbar«, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Gewerkschaften.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.