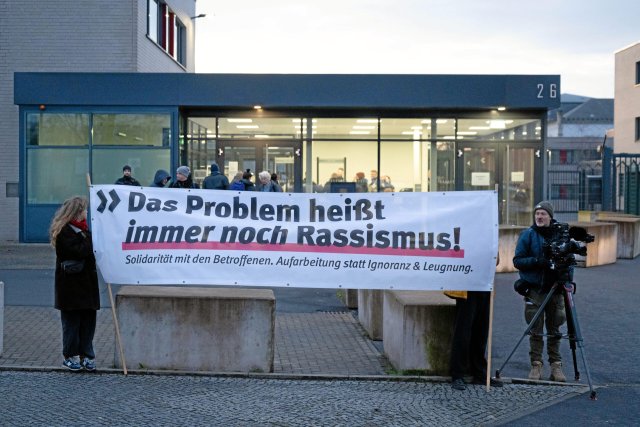Wo man geht und steht
Frankreich auf Weg zum Tracking von Corona-Infizierten
Frankreichs Nationalversammlung berät in diesen Tagen über die Bedingungen der für den 11. Mai geplanten Beendigung des seit dem 17. März geltenden Ausgehverbots zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie. Präsident Emmanuel Macron und Premier Edouard Philippe wollen die Oppositionsparteien an diesem Prozess weitgehend beteiligen, damit die Rückkehr zu einem geregelten Leben in Wirtschaft und Gesellschaft von einem möglichst großen Teil der Bevölkerung mitgetragen wird. Obwohl der Premier seine Absichten per Regierungsdekret durchsetzen könnte, ist zum Abschluss der Debatte eine Abstimmung geplant.
Als demokratische Geste und weiteres Zugeständnis an die Opposition dürfen an der heutigen Plenartagung 75 der eigentlich 577 Abgeordneten des Parlaments teilnehmen. Zuletzt konnten aus Gründen des Ansteckungsschutzes immer nur insgesamt zwei Dutzend Vertreter der Fraktionen präsent sein, um das Wort zu ergreifen und mit den Vollmachten ihrer abwesenden Kollegen abzustimmen. Trotz dieser Gesten dürfte es eine kontroverse Debatte werden, zumal zu den umstrittenen Themen die Ortung von Coronapatienten mit Hilfe ihres Mobiltelefons gehört. Dieses sogenannte Tracking wird massiv von den rechtskonservativen Republikanern gefordert, während es von der linken Opposition abgelehnt wird und innerhalb der die Regierung tragenden Bewegung En marche die Meinungen geteilt sind.
Die Absicht der Regierung ist es, positiv getestete Coronapatienten zu überzeugen, der Ortung und Verfolgung ihres Handys zuzustimmen, damit andere Bürger gegebenenfalls gewarnt werden können, dass sie einem Coronavirusträger nahe gekommen sind. Sie sollten sich dann testen lassen und bei positivem Ergebnis in Quarantäne gehen. So soll die Kette der Ansteckungen durchbrochen werden.
Voraussetzung ist, dass möglichst viele Mobiltelefonbesitzer mitmachen und die App StopCovid installieren. Dabei laufen die Daten über einen zentralen Server, der Warnmeldungen automatisch versendet. Nicht nur unter Politikern und Medizinern ist das Verfahren umstritten. Fachleute geben zu bedenken, dass nur 60 Prozent der Franzosen ein für die Applikation geeignetes Handy besitzen. Da auch von denen viele nicht teilnehmen dürften, sei der epidemiologische Effekt äußerst fragwürdig. Die größten Differenzen gibt es über die Zentralisierung der Personendaten und damit die Frage, wer den Server kontrolliert und einen Missbrauch der Daten verhindert.
Noch Anfang des Monats wollte die Regierung von der Handy-Ortung nichts wissen. »Das gehört nicht zur Kultur der Franzosen«, sagte Innenminister Christophe Castaner. »Ich vertraue den Bürgern, dass sie sich diszipliniert an Maßnahmen wie dem Ausgehverbot halten, und dass wir nicht solche technischen Lösungen einsetzen müssen, die in die individuellen Freiheiten eingreifen, wenn sie effizient sein sollen. Das ist ein Thema, an dem wir nicht arbeiten.«
Inzwischen lässt die Regierung mit Hochdruck an der Handy-App arbeiten, die jedoch nicht vor Ende Mai einsatzbereit sein dürfte. Dagegen wird das Tracking von den linken Parteien und von Menschenrechtsorganisationen nach wie vor abgelehnt. Hier sieht man zu große Gefahren einer illegalen Sammlung und Nutzung persönlicher Daten. Solche Techniken seien bisher flächendeckend und dadurch erfolgreich vor allem in Ländern eingesetzt worden, die autoritär regiert werden wie Hongkong und Singapur. Oder wo, wie in Südkorea, der Schutz individueller Freiheiten wenig Tradition hat. Für Frankreich lehnen die Kritiker diese Techniken ab. Sie verweisen auf Skandale wie den Missbrauch der Facebook-Daten von Millionen US-Bürgern durch die britische Firma Cambridge Analytica zur Beeinflussung der Präsidentschaftswahl 2016 zugunsten von Donald Trump.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.