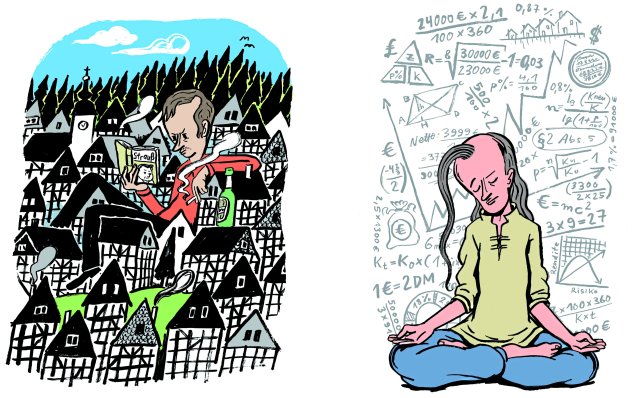Also hakt der Enkel nicht nach
Der Dokumentarfilm »Mein Opa, Karin und ich« über die Blessuren, die vererbt werden
Dass Robert früher ein Familientyrann gewesen ist, merkt man dem gebrechlichen über 90-Jährigen noch heute an. Allein wie er seine ebenso betagte Frau mit einem herrischen »Gunda!« herbeiruft aus den gemeinsamen Zimmern in dem Münchener Betreuten Wohnen, spricht bereits Bände. Rechthaberisch geriert sich der Greis auch gegenüber seiner Tochter Karin. Karin ist die Mutter des Regisseurs Moritz Springer, der mit dem Dokumentarfilm »Mein Opa, Karin und ich« sowohl Familien- als auch Zeitgeschichte aufarbeiten will.
Zeit ihres Lebens hat Karin unter ihrem autoritären Vater, aber auch unter der teilnahmslosen Mutter gelitten und versucht, sich von den Eltern abzugrenzen. Wo im Elternhaus konservative Werte hochgehalten wurden, setzte sie in den 1970er und 1980er Jahren auf WG und antiautoritäre Erziehung. Überhaupt geht es in Springers Film viel um Selbstverwirklichung, um Zeit für sich selbst, Abstand zur Familie, aber auch um gesuchte oder ersehnte Nähe zu ihr. Familie eben: Man liebt sie, man verflucht sie, man sucht sie sich nicht aus.
Der Anstoß zur Familienerkundung geht vom Regisseur selbst aus. Der in Brandenburg lebende Filmemacher bricht zu Beginn der Dokumentation nach Bayern auf, um wieder für die Großeltern da zu sein. Denn sein an Schläuchen hängender Großvater baut merklich ab, läuft schlecht, hört schlecht und lallt mehr, als dass er spricht. So wirkt der Enkel als Protagonist, Chronist und Fragenstellender in einem: mal vor, mal hinter der Kamera. Dabei neutral zu bleiben, geht nicht. Daran stößt sich der Filmemacher immer wieder, auch wenn es ihm offenbar nicht immer bewusst ist.
Wie steht es etwa um die Nazivergangenheit des Großvaters? Er war in der Waffen-SS, hatte sich freiwillig gemeldet, gehörte später der SS-Totenkopf-Division an. Das bezeugen schriftliche Dokumente und Fotos, die beim Blättern der Familienalben gezeigt oder in Großaufnahme eingeblendet werden. Ob ihm seine NS-Vergangenheit leid tue, fragt ihn Springer. Doch der alte Mann wiegelt ab: »Was soll mir da leid tun?« Er habe nicht ausweichen können, habe keinem Leid zugefügt.
Das darf ein externer Betrachter anzweifeln, war Robert Scharf doch zwischen 1943 und 1944 im polnischen Krakau »im Einsatz«, wie er es nennt. Und das mitten in einer Hochburg des Holocausts, in einer Stadt mit einem großen jüdischen Ghetto, vor deren Toren das KZ Plaszow und 60 Kilometer weiter entfernt Auschwitz lagen. Auch in Ungarn war Scharf 1944 stationiert, sicherlich nicht in friedlicher Mission. Doch eine Familiendoku ist keine historische Untersuchung. Wer will sich schon das Andenken an den liebevollen Opa aus der Kindheit verderben?
Also hakt der Enkel nicht nach. Weicht Springer dem biografisch-familiären Widerspruch aus Befangenheit also aus, fällt das Urteil Karins über ihren Vater um so heftiger aus. Sie findet bittere Worte: über dessen brutales Verhalten - inklusive Brüllen und Schlägen - und über dessen NS-Vergangenheit, die in der Bundesrepublik nach dem Krieg kein Hindernis für ein beschauliches Leben war.
So streift der Film auch Themen wie die halbherzige Entnazifizierung durch die US-Amerikaner oder die von (west-)deutschen Behörden ausgestellten Persilscheine. Vor allem ist »Mein Opa, Karin und ich« jedoch eine Familiengeschichte, deckt auf, wie Blessuren sich von einer Generation auf die nächste in verschiedener Form übertragen. Fühlte sich Karin von ihren Eltern als Kind ungeliebt, kann sie ihnen auch heute keine Liebe geben. Sie kümmert sich zwar - aus Verantwortungsbewusstsein.
Doch auch zwischen Karin und Sohn Moritz klaffen emotionale Wunden auf. Der Off-Kommentar des Films ist in Briefform an die Mutter gehalten und reflektiert durch die direkte Ansprache ihre persönliche Beziehung sowie die Eigenheit der Mutter, in Krisensituationen Briefe an Familienmitglieder zu schreiben, aber nicht abzuschicken. Visuell spielt sich der Film vor allem in den engen Zimmern des betreuten Wohnens der Großeltern ab, einem Ort, der zumindest eine physische Flucht verhindert und sich von der großzügigen Künstlerwohnung von Springers Eltern Karin und Bernhard abhebt.
Nicht immer trifft Moritz Springer in seinem Film den richtigen Ton - manches wirkt zu oberflächlich, anderes wiederum zu intim. Doch dem Film geht es weniger um (historische) Fakten, genaue (Familien-) Daten oder schmerzliches Nachbohren. Im Vordergrund stehen Befindlichkeiten von unterschiedlichen Familienmitgliedern: In ihrer Widersprüchlichkeit und ihren Reibungen stehen Robert, Karin und Moritz Springer für eine durchschnittliche BRD-Familie der Nachkriegszeit.
»Mein Opa, Karin und ich«, ab 25. April in der ZDF-Mediathek und am 27. April um 0:35 Uhr im ZDF.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.