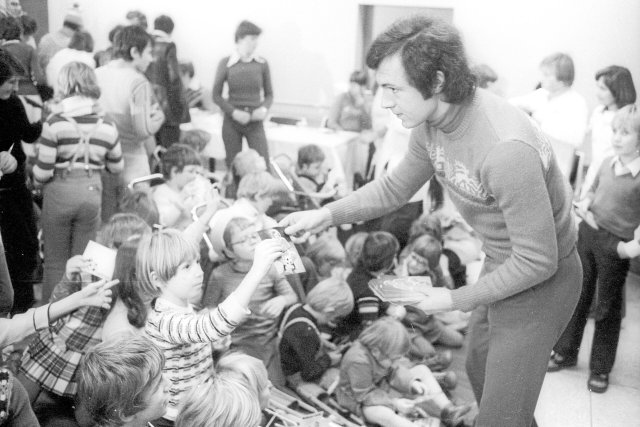- Kultur
- Sam Peckinpahs »Getaway«
Wenn jeder käuflich ist
Vergesst Arthaus! Vor 50 Jahren schuf Sam Peckinpah mit »Getaway« ein Meisterwerk des Realismus

Man kann diesen Film so erzählen: Ein Verbrecher wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Doch der Preis ist hoch. Seine Ehefrau muss mit dem Sheriff schlafen. Zudem soll er in dessen Auftrag eine Bank überfallen. Dabei geht einiges schief. Verbrecher und Frau müssen flüchten. Es kommt zu Verfolgungsjagden.
Man kann diesen Film auch anders erzählen: Als der Westen Amerikas noch wild war, gab es Männer, die trugen Hüte mit einer breiten Krempe – die Cowboys. Und wenn sie in Filmen der 50er und frühen 60er mitwirkten, kämpften sie für das Gute und hießen Gary Cooper oder John Wayne. Natürlich erzählten diese Filme nicht mal die halbe Wahrheit. Und zu der Zeit, als der Krieg in Vietnam eskalierte, hatten die Kinobesucher solche Märchen satt. Lieber sahen sie Filme, in denen die Cowboys nicht gut waren, sondern grausam. Wie in Sam Peckinpahs Western von 1969 »The Wild Bunch«, in dem am Ende fast alle tot sind.
Auch »Getaway« ist ein Western, aber einer, der in der Gegenwart spielt. Es gibt darin Männer, die Cowboyhüte tragen. Sie sind Politiker und Geschäftsleute, doch ihr Firniss der Zivilisation ist hauchdünn. Man begreift schnell: Sie werden zur Waffe greifen, sobald sie auf friedlichem Weg nicht weiterkommen. Sie sind die Bösen. Nur kann es in einer finsteren Welt keine Lichtgestalten geben. Daher sind bei Sam Peckinpah auch die Guten fragwürdige Gestalten. Impulsive Menschen, die sich nicht im Griff haben. Wie der Bankräuber »Doc« McCoy (Steve McQueen), der in einem Eifersuchtsanfall seine Frau Carol (Ali MacGraw) schlägt, die ihrerseits eine Vergewaltigung mit einem Mord rächt – im Western zieht man den kurzen Prozess dem Gerichtsverfahren vor.
Ja, sogar die braven Bürger verlieren jede Selbstbeherrschung, wenn man sie Extremsituationen aussetzt. Als ein angeschossener Bandit einen Tierarzt und dessen Frau zur Geisel nimmt, entwickelt diese ein Stockholm-Syndrom und mutiert zum Gangsterliebchen. Und ein Hotelbesitzer, dem der gejagte Doc vertraut, wird zum Verräter, kaum dass man ihn unter Druck setzt – von Loyalität und Rückgrat keine Spur!
In der Welt des Sam Peckinpah ist jeder Mensch ein potenzieller Übeltäter. Hinter sauberen Anzügen stecken schmutzige Charaktere. Da entpuppt sich ein Kavalier als Trickbetrüger. Und die Amtsträger betreiben Machtmissbrauch. Dass der Vorsitzende des Bewährungsausschusses bestechlich ist, hat sich bis zu den Gefangenen herumgesprochen. In »Getaway« ist jeder käuflich. Selbst der sympathische Fluchthelfer lässt sich am Ende großzügig entlohnen.
So weit, so schlecht. Das Bemerkenswerte daran ist, dass es sich bei diesem brutal realistischen Film um einen Blockbuster handelt. Bei gut drei Millionen Dollar Produktionskosten spielte »Getaway« fast 37 Millionen ein – nach heutiger Kaufkraft über 260 Millionen Dollar. Dennoch ist dieses unter kapitalistischen Bedingungen produzierte Mainstreamwerk wirklichkeitsgetreuer als das meiste, was seit den Neunzigerjahren unter »Independent« läuft. Denn der typische Arthausfilm aus Amerika und Westeuropa ist im Grundton versöhnlich. Was er als Radikalität verkauft, ist in Wahrheit Exzentrik. Da wimmelt es von kauzigen, aber letztlich liebenswerten Gestalten, von Nerds und verträumten Außenseiterinnen (hat da jemand »Amélie« gerufen?), die am Ende ihre Nische in der Welt der Normalos finden.
Sam Peckinpah ist illusionsloser. »Getaway« findet in Mexiko sein Ende. Und während der Fluchtwagen am Horizont verschwindet, weiß man: Für den Doc und seine Frau Carol wird es in den USA garantiert keine Zukunft geben.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.