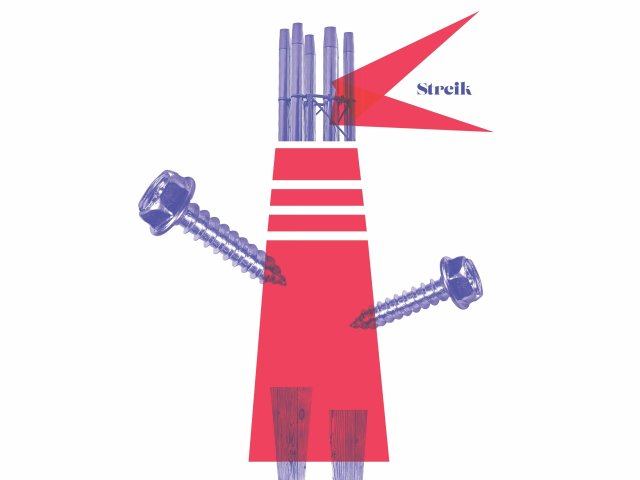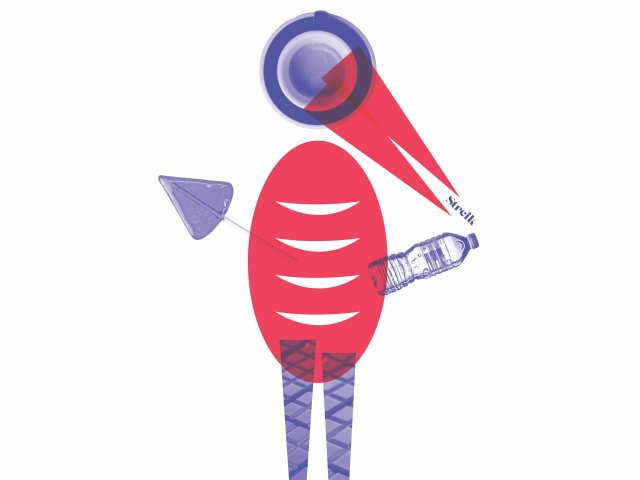- Politik
- Tabu Fehlgeburt
»Wie eine Narbe, die immer bleibt«
Michelle Mundt spricht offen über den Verlust ihres ungeborenen Kindes. Damit ist sie eine Ausnahme
Michelle Mundt sagt: »Ich bin Mutter von drei Kindern.« Sie sagt es mit fester Stimme. Doch sie wird nur zwei dieser Kinder aufwachsen sehen, mit ihnen Einschulung und Schulabschluss feiern, erleben, wie sie eigene Familien gründen. Denn von einem ihrer Kinder hat Mundt nur Ultraschallbilder und einen Ausdruck, auf dem der Herzschlag des Ungeborenen zu sehen ist. Für die Mittdreißigerin sind das Beweisstücke dafür, dass vor etwa eineinhalb Jahren ein neuer Mensch in ihr wuchs. »Mit dem Herzschlag war da für mich Leben«, sagt sie, »Leben, das wir verloren haben.« Denn Michelle Mundt hat vor eineinhalb Jahren eine Fehlgeburt erlitten. Ihr ist wichtig zu betonen, dass auch ihr Mann ein Kind verloren hat.
Im deutschen Recht wird zwischen Fehl- und Totgeburt unterschieden. Als tot geborenes Kind gilt ein Embryo beziehungsweise Fötus, wenn sein Gewicht über 500 Gramm liegt oder die 24. Schwangerschaftswoche erreicht wurde. Ist die sogenannte Leibesfrucht leichter und vor diesem Zeitpunkt gestorben, spricht der Gesetzgeber von einer Fehlgeburt. Letztere gilt aus juristischer Sicht nicht als Entbindung. Die betroffenen Frauen haben deshalb keinen Anspruch auf Mutterschutz, also auf mindestens vier Wochen bezahlte Freistellung von der Arbeit.
Wegen der Unterscheidung werden auch nur tot geborene Kinder statistisch erfasst, Fehlgeburten dagegen nicht. »Von 1000 Geburten kommen in Deutschland ungefähr zwei bis drei Kinder tot zur Welt«, heißt es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Jungen seien »etwas häufiger betroffen als Mädchen«.
Wie viele Familien in Deutschland pro Jahr einen solchen Schicksalsschlag verkraften müssen, lässt sich nur grob schätzen. »Exakte Daten zu Fehlgeburten gibt es nicht, da sie in den ersten Schwangerschaftswochen oft subklinisch verlaufen und als Unregelmäßigkeiten des Menstruationszyklus gedeutet werden«, heißt es aus dem Thüringer Gesundheitsministerium. Anders als Totgeburten müssten Fehlgeburten zudem nicht den Standesämtern gemeldet werden, weshalb ihre Zahl nicht genau erfasst werde.
Die BZgA schätzt, dass bis zu 15 Prozent aller festgestellten Schwangerschaften mit einer Fehlgeburt enden. Das heißt, dass jedes siebte Ungeborene bis zur 23. Schwangerschaftswoche im Mutterleib stirbt. Die Zahl betroffener Familien ist also groß. Es sind Menschen, deren Bedürfnisse in öffentlichen Debatten allzu oft unsichtbar bleiben.
Bei Michelle Mundt – die anders heißt und in einer Stadt in Thüringen lebt, deren Namen hier auch nicht genannt werden soll – verlief die erste Schwangerschaft noch völlig unauffällig. »Ich hatte null Probleme, es ging mir blendend«, erzählt sie. Bis hin zum Verlauf der Geburt habe es keinerlei Komplikationen gegeben. »Für mich war das alles blumig und rosarot.«
Auch die zweite, ebenfalls gewollte Schwangerschaft verlief zunächst problemlos – bis Mundt in der neunten Schwangerschaftswoche eines Morgens zur Arbeit fuhr und ein anderer Verkehrsteilnehmer in ihr Auto krachte. »Scheinbar nur ein Blechschaden«, sagt sie. Zunächst habe alles so harmlos gewirkt, dass die hinzugezogenen Polizisten sich zunächst geweigert hätten, einen Krankenwagen zu rufen, obwohl sie ausdrücklich auf ihre Schwangerschaft hingewiesen habe. Erst als sie darauf bestanden habe, sei der Rettungsdienst geholt worden. »Die haben die Polizisten dann ziemlich zusammengepfiffen«, sagt Mundt. Anfang 2022 war das. In der Klinik wurde bei ihr noch am Unfalltag ein Routinecheck vorgenommen. Zunächst war dabei alles unauffällig. »Zwei Tage später hatte ich dann starke Schmerzen und Blutungen«, erzählt die Thüringerin. Sie kam wieder in die Notaufnahme. Weil gerade die letzte große Corona-Welle durch das Land rollte, musste ihr Mann sie am Morgen am Klinikeingang verabschieden. »In der Notaufnahme ist dann festgestellt worden, dass da keine Herztöne mehr sind«, sagt Mundt. Ein paar Stunden später wurde der verstorbene Fötus aus ihrer Gebärmutter entfernt.
Am späten Nachmittag dieses Tages wurde Michelle Mundt von ihrem Mann aus der Klinik abgeholt. »Unschwanger«, sagt sie. Das Wort klingt sehr nüchtern. Es ist eine treffende biologische Zustandsbeschreibung. Dass sie, die sich als Mutter von drei Kindern sieht, den Ausdruck benutzt, darf als ein Zeichen dafür gelten, wie schwierig und herausfordernd der Umgang mit dem Thema für sie sein dürfte.
Bis heute wird in Deutschland über den Verlust ungeborener Kinder wenig gesprochen. Anders als etwa Depressionen und andere psychische Erkrankungen sind Fehl- und Totgeburten immer noch ein weitgehend tabuisiertes Thema. Zwar sind auch Depressionen kein Thema für Small Talk oder für Gruppengespräche mit nahezu Fremden. Doch über sie wird mittlerweile zumindest in der Bundesrepublik viel selbstverständlicher gesprochen als über Fehlgeburten – trotz der riesigen Zahl Betroffener.
Allein in dem Sportverein, in dem sie aktiv sei, sagt Mundt, gebe es mehrere Frauen, die schon mindestens eine Fehlgeburt erlitten hätten. Keine von ihnen habe bis vor Kurzem von den Geschichten der anderen gewusst. Erst als sie im Verein begonnen habe, offen von ihrem Verlust zu erzählen, hätten sich auch die anderen Frauen langsam geöffnet.
Bei anderen Menschen, mit denen sie über ihre Fehlgeburt habe sprechen wollen, zum Beispiel, um zu erklären, warum sie vor einiger Zeit einige Tage nicht auf der Arbeit gewesen sei, sei sie dagegen auf völliges Desinteresse gestoßen. »Bei vielen ist da so eine Haltung von ›Reden wir lieber nicht drüber‹«, meint Mundt. Nicht einmal mit ihren eigenen Eltern könne sie wirklich über ihre Erfahrung sprechen.
Ein wesentlicher Grund für das Schweigen und Abblocken liegt sicherlich darin, dass das Thema besonders schmerzhaft ist. Wer redet schon gerne über tote Kinder und das Leid, das ihr Tod für die Hinterbliebenen bedeutet? Und schließlich ist der Tod selbst das große Tabu der modernen Gesellschaft.
Als sie in der Klinik gewesen sei und stundenlang auf den Eingriff zur Entfernung des herzschlaglosen Fötus gewartet habe, »da habe ich Rotz und Wasser geheult«, erzählt Mundt. Ganz allein habe sie in einem Krankenhauszimmer gelegen, bis eine Seelsorgerin ihr ein wenig Trost gespendet habe. »Ich habe mit Glauben nun wirklich gar nichts am Hut, aber diese Frau war meine Rettung.«
Nach der Operation, sagt Mundt, habe sie sich dann sofort selbst entlassen, trotz aller Schmerzen, »weil ich das Kindergeschrei in der Klinik einfach nicht ausgehalten habe«. Tagelang habe sie später einfach nur auf dem Sofa gelegen, zugedröhnt mit Schmerzmitteln.
Auch für ihren Mann und für ihr erstes Kind waren die Wochen nach dem Tod des Ungeborenen eine schwere Zeit. Über das, was so etwas auch für die Männer bedeute, werde noch deutlich weniger gesprochen, geschrieben und reflektiert als über das, was der Verlust für Frauen bedeute, sagt Mundt. Vielleicht auch deshalb habe sie inzwischen einigermaßen mit ihrer Fehlgeburt abschließen können, während das für ihren Mann noch nicht in dem gleichen Maße gelte. »Er sagt manchmal zu mir: ›Ich glaube, du bist damit besser zurechtgekommen als ich.‹«
Ob es ausreichend Hilfsangebote für Menschen gibt, die in einer frühen Phase der Schwangerschaft ihre Kinder verlieren, darüber gehen die Meinungen auseinander. Mundt sagt: Nein. Die Angebote, die ihr gemacht worden seien, seien entweder zum falschen Zeitpunkt gekommen oder hätten sie nicht angesprochen. Wobei Mundt reflektiert genug ist, um zu wissen, dass andere Betroffene die Lage anders sehen mögen.
Nämlich vielleicht so, wie die Fachleute im Thüringer Gesundheitsministerium, die über eine Sprecherin ausrichten lassen, aus ihrer Sicht gebe es jedenfalls im Freistaat ausreichend Unterstützung für all jene, die einen solchen Verlust verarbeiten müssten. »Von einer Fehlgeburt betroffene Eltern können sich zum Beispiel an eine Schwangerschaftsberatungsstelle wenden«, teilt die Sprecherin mit. Auch Frauenzentren, Geburtshäuser oder Selbsthilfegruppen könnten Anlaufstellen sein. »In psychosozialen Notlagen kann auch ein Beratungsgespräch bei der Telefonseelsorge in Betracht kommen«, erklärt sie weiter. In jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt gebe es mindestens ein vom Freistaat finanziertes Beratungsangebot.
Der Verein feministische Innenpolitik findet indes, dass Frauen nach einer Fehlgeburt in Deutschland zu wenig unterstützt werden. Sie müssen sich krankschreiben lassen, wenn es ihnen nicht gut geht, was bei sehr vielen von ihnen der Fall ist. Etliche werden sogar per Kaiserschnitt entbunden. Dennoch werde von ihnen grundsätzlich erwartet, dass sie unmittelbar nach der Fehlgeburt wieder bei der Arbeit erscheinen, moniert der Verein.
Die Bundesregierung will den Anspruch auf Mutterschutz auf Fehlgeburten ab der 21. Woche ausweiten. Der Verein feministische Innenpolitik findet das nicht ausreichend. In einer Petition an den Bundestag fordert er mindestens zwei Wochen Mutterschutz auch für Frauen, die ihr Kind im frühen Stadium bis zur zwölften Woche verlieren, bei längerer Schwangerschaftsdauer mehr.
Für Mundt sind es mehrere Dinge, die ihr geholfen haben, die Fehlgeburt zu verarbeiten, obwohl kein Monat vergeht, in dem sie nicht an ihr totes Kind denkt: eine kleine Trauerfeier; ein weiteres Gespräch mit einer Seelsorgerin; die Reparatur des bei dem schicksalhaften Unfall beschädigten Autos, die allerdings Monate auf sich warten ließ, weil die Versicherung des Verursachers zunächst nicht zahlen wollte. Dass Mundt seit einigen Monaten wieder schwanger ist, ist für sie dagegen ausdrücklich kein Teil der Bewältigung ihrer Erfahrung. Eben weil das Baby, das gerade in ihr wächst, für sie kein »Ersatzkind« ist. Mit ihrem Verlust glaubt sie inzwischen gut zurechtzukommen. Aber: »Das ist wie eine Narbe, die immer bleiben wird.«

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.