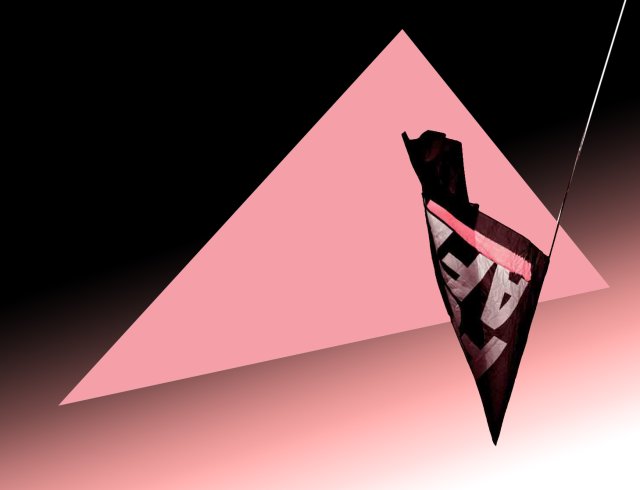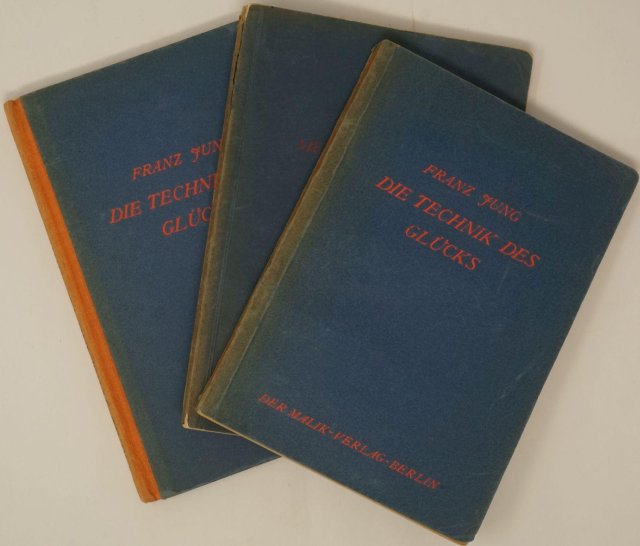- Kultur
- Sommerserie »Food for Thought«
Auferstehung der Pastinake
Food for Thought (Teil 10): Gemüsesorten, die in Kriegszeiten für Armut standen, werden derzeit mit Vorliebe von hippen Großstädtern verzehrt
Samstagvormittag auf einem Supermarktplatz: In der trostlosen Würstchenbude dreht sich der triefende Hähnchenspieß zum 80. Mal an diesem Morgen um sich selbst und wartet vergeblich darauf, verspeist zu werden. Keine fünfzig Meter weiter herrscht Volksfeststimmung: Zwischen voll beladenen Gemüseregalen tummeln sich Menschenmengen, Kunden laden sich die Einkaufswagen mit bunten Vitaminbomben voll. Sogenannte »Airfryer« für die Zubereitung von besonders kross gebackenem Gemüse sind dauerhaft ausverkauft und Abonnements werden nicht mehr mit Zeitungen, sondern mit regionalen Höfen für wöchentlich vor die Tür gelieferte Gemüsekisten abgeschlossen.
Gemüse ist gefragt wie noch nie. Früher assoziiert mit Gesundheit und Verzicht, steht es heute für Fit- und Coolness. In der digitalen Welt boomen Food-Trends wie der »Green Goddess Salad« (Grüner Salat mit Basilikum-Avocado-Spinat Dressing), »Buffalo Cauliflower Wings« (scharfe gebackene Blumenkohlröschen) oder »Corn Ribs« (knusprig gegrillte, klein geschnittene Maiskolben). Sie zeigen an: Gemüse ist nicht nur hip, es macht zunehmend auch dem deutschen Lieblingslebensmittel Fleisch Konkurrenz. Blumenkohl-Steaks, Sellerie-Schnitzel und Linsen-Bolognesen sind in den Kantinen der bürgerlichen Mitte angekommen, zeitgenössische Kochstars wie Yotam Ottolenghi stehen mit ihren Gemüse-Kochbüchern ganz oben auf den Bestsellerlisten.
In unserer diesjährigen Sommerreihe widmen wir uns der Kulinarik – in ihrer sinnlichen, sozialen und politischen Dimension.
Die Social-Media-Trends lassen erahnen, dass Verzehr von Gemüse nicht nur für einen gewissen Lifestyle steht, sondern auch Identifikationspotenzial birgt: Dabei geht es weder um emotionale Verbundenheit – Mitgefühl für arme Gürkchen oder Wut auf treulose Tomaten – noch um banale Äußerlichkeiten (»Du bist so dünn wie ein Spargel!«), sondern um Klassenzugehörigkeit.
Denn die Beziehung zu gewissen Gemüsesorten beginnt beim Finanziellen: Wer kann es sich überhaupt leisten, Lebensmittel wie den heiligen deutschen Spargel oder die ökologisch erzeugte Avocado zu kaufen? Des Weiteren zeigt der Umgang mit bestimmtem Gemüse den eigenen Hintergrund: Kennt man Rote Beete erst aus dem Raw-Food-Restaurant in Kreuzberg oder stand die Rübe schon in der Konservendose auf dem Abendbrottisch der Kindheit?
»Der Mensch ist, was er isst« trifft in diesem Sinne nicht nur auf die Beziehung zwischen Ernährung und Körper zu, sondern auch auf die Stellung des Individuums in der Gesellschaft. Die Beschäftigung mit Ernährung liegt im Trend und wird genutzt, um soziale Zugehörigkeit auszudrücken. Damit gehört ein bestimmter Ernährungsstil wie eine Gucci-Tasche als teures Statussymbol zum Lebensgefühl. Bezogen auf Gemüse hat hierbei eine Bedeutungsverschiebung stattgefunden: Auffällig ist etwa, dass Uralt-Gemüsesorten wie Pastinake, Süßkartoffel und Petersilienwurzel ihren altbackenen, unsexy Charakter hinter sich gelassen haben und die Speisekarten von Sternerestaurants zieren. Schwarzwurzeln, Topinambur oder Teltower Rübchen, die in Kriegszeiten für Armut standen, sind heute en vogue. Konservative Gemüse-Verarbeitungsmethoden wie Fermentieren oder Einwecken erleben eine Renaissance.
Dass so manches Gemüse einen Anteil an Gentrifizierungsprozessen hat, wird nicht zuletzt dann deutlich, wenn Influencer die besonders günstigen Wochenmärkte in Brennpunkt-Vierteln empfehlen. Welche Folgen hat es, wenn sich zwischen den Gemüseständen der Vorstadt-Wochenmärkte nicht mehr überwiegend Rentner, sondern zunehmend auch gut situierte Bänker aus der Stadt tummeln? Eigentlich könnte man sich über die wachsende Zahl der Gemüse-Feinschmecker freuen – doch welche Lebensmittel bleiben noch für Menschen mit einem Einkommen unter der Geringverdienergrenze, wenn die neue Gemüse-Bubble die Preise der einzig bezahlbaren Sorten mit ihren Food-Trends nach oben treibt? Der steigende Konsum von einst preiswerten Gemüsesorten wie Rüben oder Kohl heizt die sowieso schon boomenden Gemüsepreise weiter an. So haben sich Blumenkohl und Rumpsteak mittlerweile nicht nur in der Zubereitungsweise, sondern auch auf den Preisschildern einander angeglichen.
Die hippe Umcodierung des Gemüses birgt eine weitere Dimension: Gemüse wird nicht nur teurer, sondern auch immer schöner. Das makellose, glänzende Gemüse-Meer in Supermärkten ist den strengen Vorgaben des Handels zuzuschreiben. Während Auberginen nur mit perfekt poliert aussehender Schale verkauft werden dürfen, sollen die Möhren- und Kohlrabiblätter, die Händler nun gerne dranlassen, Frische verkörpern – lassen das Gemüse allerdings im Gegenteil oft schneller welk erscheinen. Belastend ist der Gemüse-Perfektionismus vor allem für die Umwelt, da das standardisierte Aussehen der essbaren Pflanzenteile nur durch einen erhöhten Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln erreicht werden kann.
Obst und Gemüse, das den Handelsvorgaben nicht entspricht, wird an die Erzeugerbetriebe zurückgewiesen und landet im besten Fall im Futtertrog, meistens aber in der Tonne. Überdies werden bestimmte Sorten wie etwa Brokkoli und Kohlrabi statt nach Gewicht zu einem festen Stückpreis verkauft, was kleinere Exemplare benachteiligt. Es scheint demnach, als hätte der kapitalistische Schönheitswahn mittlerweile auch Einzug in die Gemüseregale gehalten. Doch auch dagegen weiß die Hipsteria Abhilfe zu schaffen: Nach dem Motto »The Future is Veggie« und »Krumm, gerade, we don’t care« verschickt etwa das Start-up-Unternehmen Etepetete aus München nicht der Norm entsprechendes Bio-Gemüse in Boxen. Trotz Gentrifizierung und Diskriminierung des Gemüses aufgrund von Äußerlichkeiten gibt es also noch Hoffnung für unsere Gemüse-Gesellschaft. Nur blöd, dass die Kisten mit dem aussortierten, unperfekten Grünzeug trotzdem knapp dreißig Euro kosten und damit wohl doch ziemlich etepetete sind.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.