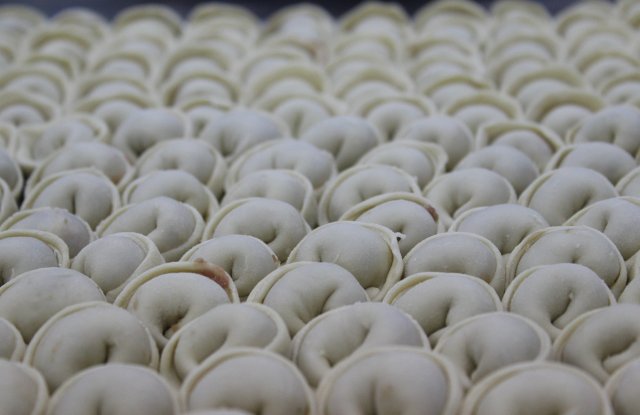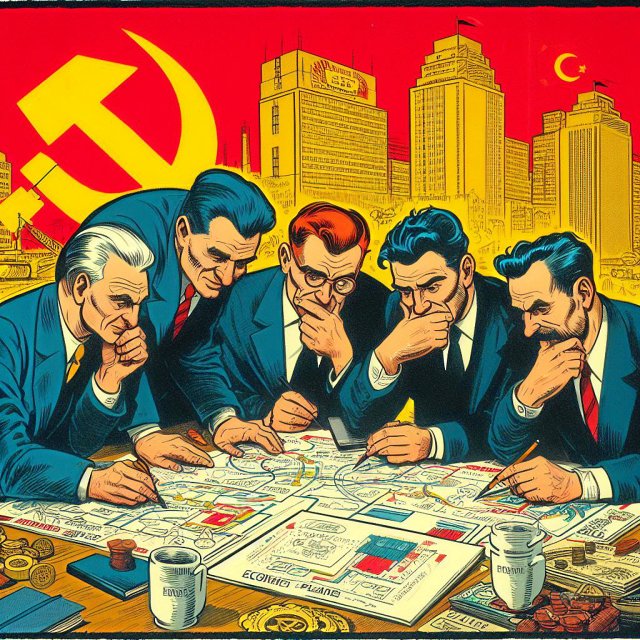- Kultur
- Mo Harawe im Interview
»Überhaupt davon zu träumen, Filme zu machen, ist schwierig.«
Mo Harawe über sein Langfilmfebüt »The Village Next to Paradise«, Eurozentrismus und Realität in Afrika

Herr Harawe, Sie sind der erste Mensch aus Somalia, dessen Film es in die Official Selection vom Cannes-Filmfestival geschafft hat. Dazu ist es Ihr Langfilmdebüt. Wie fühlen Sie sich?
Ich sehe das eher aus einer anderen Perspektive: Es ist schade, dass es erst im Jahr 2024 dazu gekommen ist. Aber besser jetzt als in zehn Jahren.
Wie ist die Geschichte zu Ihnen gekommen?
Die erste Fassung des Buches habe ich 2018 geschrieben. Damals hatte ich nicht vor, einen Film daraus zu machen. Ich war in einer Situation, in der ich gemerkt habe, dass es einen Gap, eine Kluft gab zwischen dem Land Somalia, das ich kenne und dem, was die Welt, in der ich lebte, über Somalia hat. Es sind komplett unterschiedliche Sichtweisen. Das Buch war ein Versuch, mich selbst kennenzulernen. Ich wollte aber auch nicht unbedingt Geschichten erzählen, sondern über Dinge schreiben, die man nicht erklären kann, die man vielleicht nur sehen und fühlen kann. Also nicht nur die rationalen Sachen, die passieren, sondern das Menschliche und Zwischenmenschliche: wie die Menschen sind, wie sie ausschauen, wie sie reden, was sie essen, wie sie Liebe zeigen, wie sie lügen. Das Buch habe ich dann erst 2022 wieder hervorgeholt, als eine Produktionsfirma mit mir einen Film machen wollte.

Mo Harawe wurde 1992 in Mogadischu geboren. Er besuchte eine Kunstschule in Somalia. 2009 übersiedelte er nach Österreich und studierte anschließend in Kassel Film und visuelle Kommunikation. Mit Kurzfilmen hat er Aufmerksamkeit im Filmgeschäft erregt. »The Village Next to Paradise« ist sein erstes Langfilmprojekt. Das Werk feierte 2024 in der Sektion »Un Certain Regard« des Cannes-Filmfestivals Premiere.
Sie haben mit fast 18 Jahren Somalia verlassen und sind nach Österreich gegangen. Darf ich fragen, warum?
Das ist eine lange Geschichte, keine besondere, aber einfach zu lang. Vielleicht kann ich eines Tages darüber schreiben, aber jetzt möchte ich nicht darüber sprechen.
Aber Sie dürfen jetzt ohne Probleme in Somalia drehen?
Ja, ich kann seit fünf Jahren wieder nach Somalia reisen.
Wenn man aus eurozentrischer Perspektive an Somalia denkt, dann fallen einem die Piraten, der Bürgerkrieg, die Drohnen ein. Der Film beginnt eben mit Nachrichten über Drohnen. Und dann sehen wir, wie es für die Menschen ist, die da wirklich betroffen sind.
Ja, auf jeden Fall war es das Ziel, den eurozentristischen Blick zu brechen. Ich wollte zeigen, was sich hinter den Nachrichtenbildern und den Statistiken verbirgt. Denn wenn über das Geschehen dort berichtet wird, wird oft vergessen, dass es Menschen sind. Das betrifft nicht nur Somalia. So wie man etwa über die Flüchtlinge redet, verliert das Wort dann irgendwann seine eigentliche Bedeutung. Es war für mich wichtig, gleich am Anfang des Films den Zuschauern zu zeigen: Hier ist das, was du von mir geboten bekommst und da ist deine Perspektive, gewollt oder nicht gewollt. Aber das ist das, was du konsumierst. Und das, was du konsumierst, ist eigentlich fast Unterhaltung. Die Szenen zu Beginn des Filmes sind Real Footage. Ich glaube nicht, dass jemand darüber nachdenkt, wer das ist, der durch einen Anschlag gestorben ist. Dann wird gezeigt, wie das echte Leben ist. Die Menschen in Somalia, wie andere Menschen, wo auch immer auf der Welt, haben Wünsche, suchen Arbeit, wollen ein gutes Leben leben. Aber ihre Entscheidungen im Alltag werden von außen, vom »Rest« der Welt beeinflusst – seien es jetzt Drohnen, die über sie kommen oder illegale Fischerei und was auch immer.
Ihre eigene Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte. Inwieweit haben Sie Unterstützung erfahren, inwieweit mussten Sie mit Schwierigkeiten oder gar Feindseligkeit kämpfen, um heute hier in Cannes zu sitzen?
Ich hoffe, dass der Erfolg greifbar ist. Ich stelle allerdings auch infrage, was das eigentlich heißt, erfolgreich zu sein. Ich hoffe, dass das im wahrsten Sinne auch stimmt oder weiter funktioniert. Ich glaube, Filme zu machen ist sowieso schwierig. Wenn du keine Filmschule besucht hast, umso schwieriger. Besonders in einem Land wie Österreich, wo – ich sage jetzt mal so – nur Leute Film studieren können, die finanzielle Unterstützung genießen beziehungsweise es sich leisten können. Es ist schon schwierig, überhaupt davon zu träumen, Filme machen zu können. Es scheint nicht selbstverständlich, dass jedes Kind, auch in Frankreich oder Österreich, davon träumen darf. Man muss in einer Familie aufgewachsen sein, die es ermöglichen kann. Das ist der Anfang. Das ist die erste Tür. Und selbst wenn du träumen kannst und darfst und diese Tür selber aufmachst, musst du eine Filmschule besuchen, um diese Kunst zu erlernen, um in das System hineinzukommen. Ja, es war nicht leicht in meinem Fall. Aber irgendwie hat es am Ende funktioniert. Das Risiko, aufzugeben, war höher als die Chance, es zu schaffen. Ich hatte vielleicht auch Glück.
Wie haben Sie Ihre Darsteller*innen gefunden?
Ich habe sie über Bekannte und Freunde gesucht und gefunden, weil es in Somalia keine Filminfrastruktur gibt. Man kann keinen klassischen Casting-Aufruf starten. Daher haben wir das gemacht, was wir auch bei Kurzfilmen machten: Du gehst zu den Menschen hin und fragst, ob sie jemanden kennen, der so und so ausschaut. Oder du gehst auf die Straße und sprichst Menschen direkt an und sagst: Hey, ich habe das und das vor. Meistens denken die Leute, dass man verrückt ist, weil die Leute in Somalia sich überhaupt nicht für Film interessieren. Film ist nicht so ein Ding dort. Den Hauptdarsteller für »The Village Next to Paradise«, den Vater, habe ich zum Beispiel über einen Produzenten kennengelernt. Und über ihn habe ich dann auch das Kind gefunden. Die Tante war die Einzige, bei der wir so etwas wie ein Casting gemacht haben. Unser Casting-Director hat fünf Frauen eingeladen, sie war eine von jenen.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Wenn es in Somalia keine Filminfrastruktur gibt, wie haben Sie dort gedreht? Und wie lange haben die Dreharbeiten gedauert?
Drei Monate, 64 Drehtage. Unsere Einstellung war: Wir gehen hin, wir versuchen irgendwas vorzubereiten. Wenn wir am Abend einige Sequenzen abgedreht hatten, haben wir gleich danach die Location für den nächsten Tag gesucht. Uns hat der Glaube getragen, dass es funktioniert. Ich denke, wenn wir uns vorher vorbereitet hätten, dann hätten wir vielleicht aufgegeben, diesen Film zu machen. Weil alles eigentlich dagegen sprach. Manchmal ist es besser, ins kalte Wasser zu springen und zu sagen: Okay, ich bin jetzt drin und wir machen es einfach. Viele von denen, die im Film mitspielen, waren zum ersten Mal an einem Filmset und haben noch nie irgendwas mit Film zu tun gehabt. Und die Idee war, dass wir genau mit diesen Menschen arbeiten, die motiviert sind. Dass man ihnen Zeit gibt, geduldig bleibt und versucht, das Beste daraus zu machen.
Ist in Somalia eine Drehgenehmigung erforderlich?
Ja, natürlich musst du Drehgenehmigungen haben. Aber du musst nicht jetzt unbedingt schnell eine Straße sperren, um drehen zu können. Also allgemeine Genehmigungen brauchst du schon, aber es ist nicht so, dass es eine Zensur gibt oder dass sie dein Drehbuch lesen. Zum Glück. Und sie waren sehr unterstützend; alles, was man im Film sieht, ist in Real Locations gedreht, sogar die Szenen im Gefängnis oder im Krankenhaus. Das sind wiederum Vorteile, dort zu drehen, im Vergleich zu Europa, wo alles bürokratisch lange dauert.
Haben Sie in Österreich Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit erlebt?
Natürlich, das erlebt man überall. Aber das ist jetzt nicht etwas Neues.
Wann haben Sie entschieden, Filme zu machen?
Es gibt keinen konkreten Moment, wo ich gesagt habe, ich werde Filmemacher. Ich habe das irgendwann ernst genommen. Anfangs habe ich dies und das geschrieben und Videos gemacht. Und irgendwann gab es kein Zurück mehr. Ich hatte nicht den Traum, Filmemacher zu werden.
Was wollten Sie denn werden?
Ich weiß es nicht, ich hatte kein Ziel.
Sie haben in einem Interview gesagt, dass es in Somalia kein Kino gibt. Wie war es dann für Sie, als Sie zum ersten Mal in einem Kino einen Film auf der Leinwand gesehen haben? Erinnern Sie sich daran?
Ich kann mich nicht erinnern, wo und wann das war, aber ich bin mir sicher, dass das etwas Besonderes war. Ich habe jetzt lange keine Filme gesehen, weil ich mit meinem Film beschäftigt war. Und dann war ich in Cannes und habe den Eröffnungsfilm der Sektion »Un Certain Regard« gesehen, aber auch den chinesischen Film »Black Dog«. Wow! Also dieses Gefühl hat man immer. Aber ich bin mir sicher, dass es noch besonderer war, damals zum ersten Mal auf einer Leinwand einen Film zu sehen.
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.