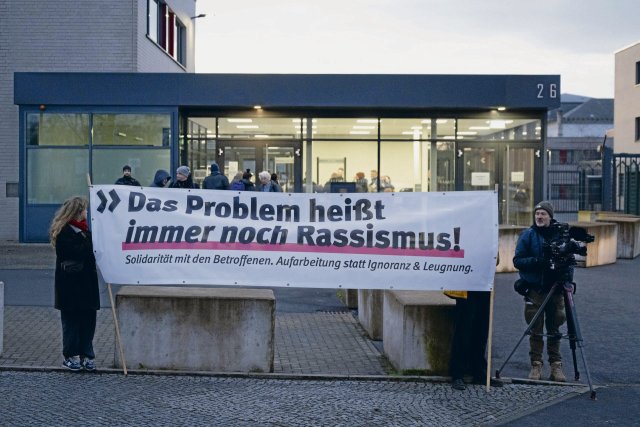- Politik
- El Salvador
Trumps Mann in El Salvador
Der diktatorisch regierende Präsident Nayib Bukele lässt endgültig die Maske fallen

Er bezeichnete sich selbstironisch als »coolsten Diktator der Welt«. Das war 2023. Damals warfen Kritiker*innen Nayib Bukele vor, die salvadorianische Verfassung durch die ihm hörigen Richter*innen beugen zu lassen, um zur Wiederwahl als Präsident antreten zu können. Bukele focht das nicht an. Weil er die Sicherheitslage in El Salvador durch die Massenverhaftung von Mitgliedern der kriminellen Banden Mara Salvatrucha (MS) 13 und Barrio 18 in den Griff bekommen hatte, wusste er die Bevölkerung hinter sich. Auch international schwang bei der Beurteilung seiner Politik, trotz der Verhaftung zahlreicher Unschuldiger, oft so etwas wie Bewunderung mit.
Tatsächlich gewann Bukele die verfassungswidrige Wahl im Februar 2024 mit überwältigender Mehrheit. Seine Popularität bleibt groß. Doch zuletzt begann sein Image im Ausland zu bröckeln. Jüngst nannte ihn das Londoner Wirtschaftsmagazin »The Economist« skrupellos. Anlass war die Verhaftung von Ruth López, der Menschenrechtsanwältin der kirchlichen Organisation Cristosal, am 18. Mai des Jahres. Die Regierung will López unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Prozess wegen illegaler Bereicherung machen.
Doch die Anwältin ist nicht die erste politische Gefangene des Regimes, bereits zuvor hatte die Bukele-Regierung Aktivist*innen verhaftet. Unter ihnen befindet sich der Unternehmer und Menschenrechtler Fidel Zavala, der es nach einem Haftaufenthalt gewagt hatte, den Vizeminister für Öffentliche Sicherheit und zwei Gefängnisdirektoren wegen Korruption und Folter in den Haftanstalten anzuzeigen. Nun befindet er sich unter der Anschuldigung, Mitglied einer illegalen Vereinigung zu sein, erneut in eben dem Mariona-Gefängnis, dessen Missstände er anprangerte.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung unterhält mehr als zwei Dutzend Auslandsbüros auf allen Kontinenten. Im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit »nd« berichten an dieser Stelle regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Entwicklungen in den verschiedensten Regionen. Alle Texte auf: dasnd.de/rls
Kampf gegen das Bandenwesen
Wer Bukeles politische Karriere verfolgt, dürfte von der aktuellen Entwicklung nicht überrascht sein. Bukeles Aufstieg begann 2015 als gerade einmal 33-jähriger Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador – und das ausgerechnet als Kandidat der ehemaligen linken Guerillabewegung und Regierungspartei FMLN. Als diese ihn nicht zu ihrem Präsidentschaftsanwärter für die Wahl 2019 machen wollte, gründete er seine eigene Partei, Nuevas Ideas, und profilierte sich als Gegner des politischen Establishments. Nach einem erfolgreichen Wahlkampf in den sozialen Medien landete er einen Erdrutschsieg.
Einmal an der Regierung legte er schnell die Grundlage für seinen langfristigen Machterhalt – trotz Wiederwahlverbot. Mithilfe seiner Parlamentsmehrheit wechselte er in seiner ersten Amtszeit alle fünf obersten Richter und den Generalstaatsanwalt aus. Bei Polizei und Militär konnte er ohnehin auf Gefolgschaft setzen.
Bukele reduzierte die Sitze im Parlament für die folgende Regierungsperiode und schnitt die Wahlkreise neu zu. Das begünstigte seine Partei: Sie stellt nun 54 der nur noch 60 Abgeordneten. Die FMLN ist nicht einmal mehr im Parlament vertreten.
Im März 2022 ermordeten die Banden MS-13 und Barrio 18 an einem einzigen Wochenende 87 Menschen. Der Präsident dekretierte den Ausnahmezustand, den das Parlament seitdem regelmäßig verlängert. Bukele nutzte die Situation für ein beispielloses Vorgehen gegen die Banden. Polizei und Militär durchkämmten systematisch vor allem die ärmeren Viertel der Städte und die ländlichen Gegenden mit starker Präsenz der Banden. Die Kehrseite: Die Versammlungsfreiheit ist eingeschränkt, das Recht auf private Telekommunikation ebenso und die Chance auf ein faires Gerichtsverfahren gering. Die Prinzipien des Rechtsstaates gelten nicht mehr.
Inzwischen befinden sich, je nach Angaben, knapp 2 bis 2,5 Prozent der Bevölkerung in Haft. Das ist Weltrekord. Bei einer Bevölkerung von gut sechs Millionen sind das weit über 100 000 Menschen; fast alle von ihnen warten auf einen Prozess. Angekündigt sind Massenprozesse, bei denen Richter*innen mit geheim gehaltener Identität Strafen zwischen 20 und 40 Jahren verhängen sollen. Die erwähnte Organisation Cristosal berichtet über die Bedingungen in den Gefängnissen: extreme Überbelegung in Sammelzellen, Krankheiten, Lebensmittel- und Medikamentenentzug, fehlende Hygienemöglichkeiten. Die Unterbringung erfolgt oft in alten, maroden Gefängnissen. Mehrere Hundert Menschen sind dort in den vergangenen Jahren unter ungeklärten Umständen umgekommen. Selbst die Regierung musste inzwischen eingestehen, dass sich unter den Verhafteten auch Tausende Unschuldige befinden.
Der Deal mit Trump
Weltweites Aufsehen erregte das 2023 eingeweihte Hochsicherheitsgefängnis Cecot mit einer Kapazität für 40 000 Personen. Die Gefangenen müssen dort unter spartanischen Bedingungen und extremsten Sicherheitsvorkehrungen überleben. Im Rahmen einer Medienkampagne führt Bukele die Insassen in martialischen Videos regelrecht vor. Jana Flörchinger von Medico International schreibt von einer »Pädagogik der Grausamkeit«.
Donald Trump hatte Bukele in seinem eigenen Wahlkampf noch vorgeworfen, Mörder in die USA zu schicken. Doch der salvadorianische Präsident nutzte seine Chance bei persönlichen Treffen mit Trump und US-Außenminister Marco Rubio. Er bot an, in seinen Gefängnissen gegen Bezahlung auch angebliche Straftäter*innen aus dem Ausland aufzunehmen. Bald darauf schoben die USA trotz richterlichem Verbot unter anderen 238 Venezolaner*innen in den Strafvollzug nach El Salvador ab. Auch hier gilt: Ein Großteil dieser Personen ist vermutlich unschuldig, hatte teilweise eine Arbeitserlaubnis und einen Aufenthaltstitel. Doch Bukele ist dies egal, eine gute Beziehung zu Trump ist ihm wichtiger. Internationales Aufsehen erregte vor allem die rechtswidrige Deportation des in den USA lebenden Salvadorianers Kilmar Abrego, der inzwischen nach Protesten wieder in die USA überstellt und dort angeklagt wurde.
Zuletzt stellten einige Informationen Bukeles Selbstdarstellung infrage. Das angesehene digitale Medium »El Faro« veröffentlichte Anfang Mai Video-Interviews mit zwei Anführern der Bande Barrio 18 Revolucionarios. Deren Aussagen unterfüttern Gerüchte, die seit Jahren im Umlauf sind. Bandenführer Carlos Cartagena schildert in einem der Videos detailliert Kontakte mit dem direkten Umfeld Bukeles seit 2014, als der heutige Präsident für das Bürgermeisteramt in der Hauptstadt kandidierte. Die Banden übten demnach Druck auf Wähler*innen aus, um deren Stimmen für Bukele zu sichern. Als Gegenleistung soll Geld geflossen sein. Die Interviewten berichten auch über Privilegien für verhaftete Bandenführer bis hin zur Fluchthilfe.
Auf die Enthüllungen antwortete die Regierung mit unverhüllten Drohungen gegen »El Faro« und die unabhängigen Medien. Dies ist nichts grundsätzlich Neues. Gegen mindestens sechs Journalist*innen liegen Haftbefehle vor. Die Journalistenvereinigung von El Salvador (APES) registriert in den vergangenen zwei Jahren einen enormen Anstieg staatlicher Einschüchterungen; die Organisation Reporter ohne Grenzen kommt zum gleichen Ergebnis. Eine Reihe Journalist*innen hat das Land verlassen beziehungsweise eine Rückkehr in Bukeles El Salvador ausgeschlossen.
Kampagne gegen »ausländische Agenten«
Vor wenigen Wochen machte Bukele mit einem bereits länger geplanten Vorhaben ernst: Er holte das 2021 erarbeitete Gesetz über ausländische Agenten aus der Schublade und ließ es im Parlament absegnen. Nach dem Vorbild ähnlicher Gesetze in Russland und Nicaragua erschweren die neuen Gesetzesregelungen die internationale Zusammenarbeit zwischen ausländischen, vielfach gemeinnützigen Geldgeber*innen wie Hilfswerken und Stiftungen auf der einen sowie salvadorianischen Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) auf der anderen Seite.
Auf Zuwendungen an die einheimischen NGOs wird künftig eine Steuer von 30 Prozent erhoben. Wer als »ausländischer Agent« in El Salvador gegen die »öffentliche Ordnung« verstößt oder die »soziale und politische Stabilität« gefährdet, kann mit Geldstrafen bis zu 200 000 US-Dollar belegt werden. Für die in El Salvador ansässigen »Agenten« gilt eine verschärfte Registrierungspflicht in einem neu geschaffenen Register. Kommen sie dieser Pflicht nicht innerhalb von 90 Tagen nach, müssen sie ihre Aktivitäten einstellen. Viele ausländische Einrichtungen werden sich nun die Frage stellen müssen, ob ihre Arbeit in El Salvador überhaupt noch möglich ist.
Bukele sagt, er wolle mit dem Gesetz Transparenz, Sicherheit und die Souveränität des Landes fördern. Die Kritik der EU, das Gesetz verstoße gegen Vereinbarungen des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, konterte der Präsident höhnisch. Er sprach von der EU als »gealtertem, überreguliertem Block«, der von nicht gewählten Bürokrat*innen angeführt werde und dem Rest der Welt Lektionen erteilen wolle.
In der Praxis handelt es sich bei den Regelungen für »ausländische Agenten« um ein politisches Steuerungsinstrument, das der Regierung einen breiten Interpretationsspielraum einräumt. Es kann insbesondere die Arbeit missliebiger Menschenrechts- und Umweltorganisationen behindern, die finanziell oft von ausländischen Zuwendungen abhängen.
Umweltaktivist*innen gehören zu den wenigen, die noch ihre Stimme gegen die Regierung erheben. Sie stehen beispielsweise Bukeles Absicht im Weg, den Bergbau im Land großflächig zu reaktivieren. Im Dezember 2024 verabschiedete das Parlament ein entsprechendes Bergbaugesetz, das das seit 2017 bestehende Verbot des Metallbergbaus aufhebt. Der damals nach mehr als zehn Jahren Debatte erzielte Konsens gründete sich aus der Angst vor einer Verschmutzung der zahlreichen Wasserkörper in dem dicht besiedelten Land.
Keine Gegenmacht in Sicht
Seit Beginn seiner ersten Amtsperiode vor sechs Jahren hat Bukele seine autoritäre Kontrolle der salvadorianischen Gesellschaft Stück für Stück ausgebaut. Innenpolitisch ist keine Kraft erkennbar, die er fürchten müsste. Solange es dem Präsidenten gelingt, die Sicherheitslage unter Kontrolle zu halten, scheint die Mehrheit der Bevölkerung Menschenrechtsverletzungen und Armut derzeit noch in Kauf zu nehmen.
Ein Kredit des Internationalen Währungsfonds in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar für die kommenden drei Jahre und der Rückhalt der Trump-Regierung stützen den Präsidenten zusätzlich. Eine Verfassungsänderung im Dezember 2024 hat bereits die Grundlagen für eine weitere Amtszeit gelegt. Doch damit nicht genug: Bukele geht auf Expansionskurs. In Costa Rica bereitet sich seine Verwandtschaft mit dem Aufbau der Partei Avanza auf die dortige Präsidentschaftswahl im Februar 2026 vor.
Gerold Schmidt leitet das Regionalbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Mexiko-Stadt.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.