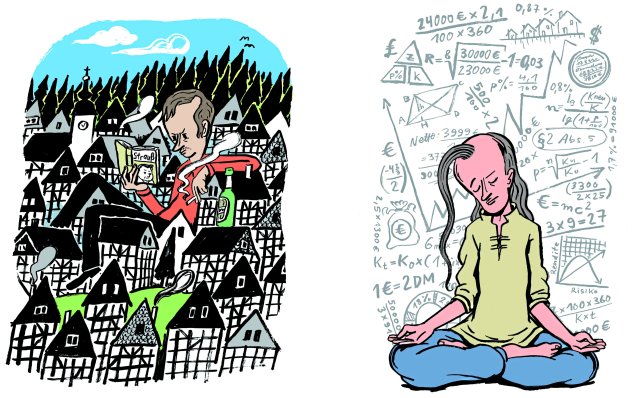- Kultur
- Mythos Wikinger
Zahnfeen aus dem Norden
Die Forschung entlarvt das Bild des Wikingers als medialen Mythos, der vor allem an Männlichkeitskult und rechte Projektionen anschlussfähig ist

Geflochtene Zöpfe, Undercuts, Tätowierungen im Gesicht und auf dem Körper, Lidschatten und Schulterfelle», das Magazin «Mittelalter Digital» fasst so das Wikinger-Klischee gut zusammen. Sie stehen für nordische Männlichkeit, in wildem Schick eingehüllte Zähigkeit, für trinkfeste Rituale und ein selbstbestimmtes Leben. Die freibeutenden Seekrieger dienen Männern heute als Schönheitsideal und sind deshalb auch beliebte Tattoo-Motive. Gehörnte Helme, Drachenboote und muskelbepackte Kerle prangen nicht nur bei Metal-Fans auf Oberarmen und Waden. Dabei waren die Nordmenschen selbst gar nicht tätowiert – und auch nicht alle Wikinger. Das kolorierte Image ist das Produkt medialer Fiktion.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Sinnbild des Sozialdarwinismus
Dass die Hörnerhelme eine unpraktische Erfindung der Richard-Wagner-Opern sind, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Andere Fakten über die Menschen, die vom 8. bis 11. Jahrhundert im europäischen Norden lebten, noch nicht. Die meisten von ihnen waren zum Beispiel keine Wikinger. Denn der Begriff «Wikinger» bezeichnete keine Ethnie oder Volk, sondern einen Beruf. Wikinger gingen auf große Fahrt und machten als Händler kaufmännisch Umsatz oder als Krieger Beute.
Die unwissenschaftliche Sammelbezeichnung für alle Nordeuropäer jener Zeit kam erst später auf. Ebenso falsch ist das Wort «Nordgermanen», mit denen vor allem die deutschen Nationalsozialisten versuchten, sich eine alte kriegerische Abstammungslinie herbei zu fantasieren. Im 19. Jahrhundert begann die Romantisierung skandinavischer Geschichte, völkische Kreise entdeckten deren mittelalterliche Kultur für sich, bis die Nazis sie komplett in den Dienst ihrer Propaganda nahmen.
Über Germanen und Wikinger konstruierten die Nazis einen Bogen vom mystischen Herrenvolk der Arier in die Gegenwart.
-
Der rassistisch-okkulte Guido von List etwa fantasierte ab 1900 ein Ariertum herbei, dessen Teil die Wikinger gewesen sein sollen. Er erfand ein Pseudo-Runen-Alphabet – die angeblich magischen «Armanen Runen» –, das esoterische Kreise bis heute benutzen. Daraus bedienten sich die Nationalsozialisten für ihr Symbolrepertoire beispielsweise dem aus zwei sogenannten «Sieg»-Runen bestehenden «SS»-Zeichen. Über Germanen und Wikinger konstruierten sie einen Bogen vom mystischen Herrenvolk der Arier in die Gegenwart, um die vermeintliche Höherrangigkeit weißer Menschen geschichtlich zu legitimieren. Wikinger verkörperten dieser Vorstellung nach die Reinheit und Stärke der «nordischen Rasse», sie wurden zu historischen Sinnbildern des nazistischen Sozialdarwinismus.
Auch außerhalb extrem rechter Kreise sind Wikinger als vermeintlich ursprünglich, kriegerisch und betont männlich zu identitätsstiftenden Figuren geworden. Dafür sind besonders die Tätowierungen verantwortlich, ohne die moderne Wikinger-Darstellungen undenkbar scheinen. Doch sind diese eben nicht faktenbasiert, wie der Archäologie Jakob Kristján Þrastarson von der Universität Islands kürzlich in einer Abschlussarbeit begründete. In «The Tattooed Warrior of the North» geht er anhand schriftlicher und materieller Quellen der Körperveränderung in den nordischen Gesellschaften nach.
Historischer Humbug
Erstmals kommt das an den Wagner-Opern geschulte Wikinger-Bild 1928 ins Kino mit der Hollywood-Produktion «Viking», mit dem deutschen Titel «Die Teufel der Nordsee». Darauf folgte ein Auf-und-Ab der Begeisterung, einprägsam blieben etwa «Die Wikinger» (1958) mit Kirk Douglas mit einem am Schluss brennenden Bootsbegräbnis. Die jüngste Wikinger-Welle begann mit dem Animationsfilm «Drachenzähmen leicht gemacht» von 2010, dessen Neuauflage gerade in den Kinos läuft. Verstärkt geriet die Wikinger-Optik aufgrund der TV-Serie «Vikings» seit 2013 zum Muss inszenierter Männlichkeit. Angeblich basiert sie auf realer Geschichte, was inhaltlich wie modisch nicht zutrifft, wie Jakob Kristján Þrastarson herausarbeitet.
Über sechs Staffeln komprimiert die mit Preisen überschüttete Serie Ereignisse aus 300 Jahren auf eine Zeitspanne von 30 Jahren. Die unterhaltsame Seifenoper im historischen Gewand ist chronologisch verdreht und ästhetisch verzerrt. Tätowierungen werden eingesetzt, um Reifeprozesse der Figuren plakativ auszustellen: für jede Kriegsteilnahme oder den Kampf mit einem Bären gibt es ein Tattoo. Obwohl der Abenteuerfilm «The Northman» 2022 ein anderes, korrigierendes Bild entwarf, steht in der öffentlichen Meinung fest: Ein Wikinger ist ein Berserker von Mann, auch weil «Vikings» mit historischer Authentizität beworben wurde.
Die Computerspiel-Adaption «Assasin’s Creed – Valhalla» knüpfte daran an und verankerte das typische Wikinger-Bild noch stärker in der Popkultur. «Lebe, kämpfe, denke, erobere wie ein Wikinger», lockt die Werbung des Spiels. In der Perspektive eines «echten» Wikingers erlebt man dessen Lebensgefühl, das in einer kriegerischen Eroberung nach der anderen besteht. «Leben ist Kampf», bekommt die Zuschauerin hier vorgeführt. Brutalität scheint alternativlos. Natürlich ist es nur ein Spiel, das aber im Schulterschluss mit den vielen anderen entsprechenden medialen Darstellungen Kampf und Wikinger gleichsetzt. Von medialen «Superspreadern» spricht der Historiker Tobias Enseleit darum. Diese könnten «auch etablierte Darstellungstraditionen durchbrechen» und entstünden «dadurch, dass sie medienübergreifende Darstellungsflüsse kanalisieren, zu etwas überzeugendem Homogenem zusammenführen und dergestalt unter dem Label des Authentischen mit großer Strahlkraft weiterverbreiten». Wenn das Bild von tätowierten Wikingern mit Undercuts herumschwirrt, kann man im Computerspiel folgerichtig sogar Frisier- und Tätowierstuben errichten.
Historisch ist all das wie gesagt das Humbug. Zwar lassen sich zu vielen Zeiten Tattoos in Europa nachweisen, der älteste Beleg ist die Gletschermumie Ötzi in Südtirol, aber bei den Skandinaviern der 8. bis 11. Jahrhunderte finden sich keine stichhaltigen Beweise dafür. Ein arabischer Reisender, der den ostskandinavischen Rus begegnete, schrieb zwar von Mustern, die ihren Körper bedeckten. Aber das ist ein Einzelbericht, der zudem offen lässt, ob die Muster lediglich aufgemalt waren. Andere Quellenhinweise gibt es nicht. Dass einige archäologische Objekte wie Nadel oder Kämme mitunter als Tätowiergerät gedeutet werden, überzeugt moderne Tätowierer nicht. Während der tätowierte Wikinger also Mythos ist, war damals tatsächlich eine andere Körpermodifikation in Mode, nämlich Zahnschmuck. Männer feilten sich horizontale Striche in die Schneidezähne und hoben diese mutmaßlich mit Rußeinreibung hervor. An 130 Männerskeletten fand man derartige Verzierungen, deren Grund die Forscher bisher nicht kennen.
Krieger mit Hakenkreuz
Dass Wikinger heute als Tattoo-Motive beliebt sind, kann man als harmlos abtun, dass sich Menschen historisch nicht belegte Wikinger-Muster stechen lassen, lässt sich als Mode ansehen. Aber die Grenzen zu nationalistischer bis extrem rechter Agenda sind fließend, werden vielleicht auch ohne Intention und unwissentlich mit bedient. Das muss allein deshalb schon angesprochen werden, weil Wikingermotivik immer wieder von rechts benutzt wird. Bekleidungsmarken wie Thor Steinar und Eric & Sons – letztere nennt sich «Viking Brand» – bauen ihr gesamtes Image darauf. Die englische Rechtsrockband Skrewdriver arbeitete mit Versatzstücken nordischer Mythologie und fand Nachahmer. Eine einflussreiche deutsche Naziband nennt sich nach Odins Pferd Sleipnir. Das neonazistische Netzwerk Blood & Honour benutzt diese Motive ebenfalls. Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt besuchten 1997 ein Wikingerfest, das der Thüringer Heimatschutz organisierte.
Diese Nähe zur Rechten kann man auch auf Wikinger- oder Mittelaltermärkten sehen – insbesondere in Osteuropa, aber nicht nur dort. «Dabei verschmelzen die Eindrücke: »Thor-Steinar- oder Doberman’s-T-Shirts mit Wikingermotiven auf der einen Seite und hakenkreuzbeladene Wikingerkostüme auf der anderen Seite kommen sich optisch so stark entgegen, dass Geschichte und rechter Livestyle wie eine ästhetische Einheit wirken«, warnt die Broschüre »Nazis im Wolfspelz« des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen. Der Text thematisiert mangelndes Problembewusstsein selbst unter Geschichtsvermittler*innen anhand der Germanen-Darstellergruppe Ulfhednar: »Die öffentliche Präsentation einer pizzatellergroßen ›Meine Ehre heißt Treue‹-Tätowierung bei der Eröffnung einer der größten Frühmittelalter-Ausstellungen der letzten Jahre in Paderborn, die überbordende, nach Selbstzeugnissen programmatische Verwendung von Hakenkreuzen bei Ulfhednar und vieles mehr. Ein besonders plakatives Beispiel sind einige Kampfschilde der Gruppe, auf denen das Hakenkreuz auf bombastische Dimensionen projiziert wird.« Erst nach Diskussionen um deren verschiedene rechte Verstrickungen wurde Ulfhednar nicht mehr von staatlichen Museen beauftragt.
Ähnliches ist auch bei Wikinger-Darstellungen zu finden, ohne die Szene insgesamt als rechts zu bezeichnen. Teile davon aber sind zu unkritisch gegenüber Graubereichen, tun das rechte Gedankengut zusammen mit einem Großteil des Publikums als harmlosen Spaß und Unterhaltung ab. Geschichtsbilder sind aber immer für die Gegenwart gemacht. Wenn die Wikingerfantasien Problematisches transportieren, dann muss die Wissenschaft korrigieren und ein Gegenbild aufbauen. Denn wo Wikinger zur unhinterfragten Tarnung von Neonazis werden, ist die Beliebtheit falscher Wikingertätowierungen das geringste Problem.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.