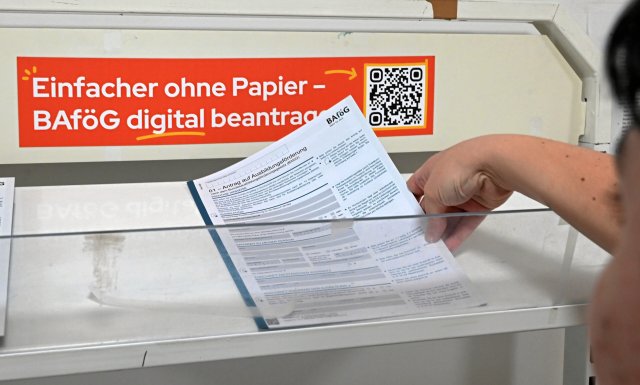- Politik
- Deutsche Vereinigung
Dass ein gutes Deutschland blühe
Brechts »Kinderhymne« wäre eine sehr passende Hymne der Deutschen. Gerade in diesen kriegerischen Zeiten

Als am 3. Oktober 1990 die DDR dem Geltungsbereich des westdeutschen Grundgesetzes beitrat, war völlig klar, wie das Projekt deutsche Einheit aussehen soll: wie eine größere Bundesrepublik – und nicht wie etwas Neues, Gemeinsames, Besseres. Das wollte ja auch die Mehrheit der Ostdeutschen, dokumentiert bei Demonstrationen und Wahlen: möglichst schnell zur D-Mark und zur vermeintlich unbegrenzten Freiheit. Zwar hatte die beginnende Arbeitslosigkeit im Osten dem Hochglanzbild schon ein paar Kratzer verpasst, aber der Drang nach Westen war weitgehend ungebrochen.
Da war es auch nicht verwunderlich, dass alle Versuche scheiterten, das Neue symbolisch deutlich zu machen. Über eine gesamtdeutsche Verfassung, die im Artikel 146 des Grundgesetzes immerhin in Aussicht gestellt wird, wollte kaum jemand reden. Und auch die Idee einer neuen gemeinsamen Hymne wurde nicht ernsthaft aufgegriffen.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Dabei lag Letzteres geradezu auf der Hand. Denn die DDR hatte eine Hymne (Musik: Hanns Eisler; Text: Johannes R. Becher), deren Text ab etwa 1970 nicht mehr gesungen wurde, weil die SED-Führung die Zeile »Deutschland, einig Vaterland« nicht mehr zeitgemäß fand. Und die Bundesrepublik hat bis heute eine Hymne (Musik: Joseph Haydn; Text: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben), deren erste beiden Strophen nicht gesungen werden, weil sie durch die NS-Zeit korrumpiert sind und darin ein Großdeutschland weit über die heutigen Grenzen hinaus umrissen wird. Und weil vor allem die Zeile »Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt« völlig disqualifiziert ist.
Doch der charmante Vorschlag, Bertolt Brechts »Kinderhymne« mit Haydns Melodie zu verknüpfen, setzte sich nicht durch. Der Text passt wohl deshalb auf diese Musik, weil Brecht ihn als lyrische Antwort auf die Zeilen von Fallersleben verfasst hat. Kürzlich hat der Linke-Politiker Bodo Ramelow das anrührende und friedensstiftende Brecht-Gedicht erneut ins Gespräch gebracht. »Anmut sparet nicht noch Mühe/ Leidenschaft nicht noch Verstand/ Dass ein gutes Deutschland blühe/ Wie ein andres gutes Land«, heißt es darin.
Er kenne viele Ostdeutsche, die die gültige Hymne nicht mitsingen, sagte Ramelow und schlug deshalb vor, über die künftige Hymne abzustimmen. Dass die alten Reflexe noch funktionieren, zeigt der Spaltervorwurf, den er sich wiederholt einhandelte. Immerhin sagte aber etwa der »Spiegel«-Autor Stefan Kuzmany, je länger er über Ramelows Vorschlag nachdenke, »desto sympathischer ist mir die Idee«. Brechts Text sei »grundsympathisch, sehr gemeinschaftsstiftend und friedfertig«, und Deutschland könne eine Debatte gebrauchen, die es zusammenbringe.
Ein AfD-Hinterbänkler entblödete sich dagegen nicht zu fordern, dass die berüchtigte erste Strophe des Liedes der Deutschen offiziell wieder eingeführt wird. Dies als Hinweis an alle, die geistlos pauschal von den politischen Rändern reden, wenn AfD und Linke gemeint sind. Plastischer kann man den Unterschied nicht illustrieren.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.