- Politik
- Antarktis
Kalter Wettbewerb um die Antarktis
Die Kürzungen der USA eröffnen China und Russland neue Spielräume

Seit über sechs Jahrzehnten gilt die Antarktis als Ort des Friedens und der Wissenschaft – festgeschrieben im Antarktisvertrag von 1959, einem der erfolgreichsten internationalen Abkommen überhaupt. Für die unterzeichnenden Staaten ist wissenschaftliche Präsenz jedoch weit mehr als reine Forschung: Sie ist Währung und Einfluss zugleich.
Lange waren die USA unangefochtene Führungsmacht in der Antarktis – mit den größten Forschungsstationen, der stärksten logistischen Infrastruktur und der höchsten Zahl an Wissenschaftlern. Doch eine Recherche des australischen Senders ABC zeigt, wie sich das Kräfteverhältnis langsam, aber stetig verschiebt. Grund: massive Kürzungen im US-Forschungsbudget.
China hat seine Aktivitäten in der Antarktis in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Peking betreibt inzwischen fünf permanente Forschungsstationen, plant eine sechste und hat im vergangenen Jahr erstmals die USA bei der Zahl der veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten überholt. Die neue Sommerforschungsstation soll in Marie-Byrd-Land in der Westantarktis entstehen – einer Region, die von keinem Staat offiziell beansprucht wird und oft als »unbeanspruchter Sektor« gilt.
Hochmoderne Anlage in strategischer Position
Nach Angaben aus chinesischen Planungsunterlagen soll die Basis zunächst nur in den Sommermonaten betrieben werden, mit einer Kapazität für rund 80 Wissenschaftler und technisches Personal. Sie wird über ein eigenes Anlegedeck für Versorgungsschiffe, Landeflächen für Helikopter und Labore für Geowissenschaften, Ozeanografie und Atmosphärenforschung verfügen. Die Bauarbeiten sollen bis 2027 abgeschlossen sein.
Offiziell wird sie als Plattform für multidisziplinäre Klimaforschung beschrieben – Experten in Australien und den USA weisen jedoch darauf hin, dass die Station mit dieser Ausstattung und Lage auch für strategische Überwachungs- und Kommunikationszwecke nutzbar wäre.
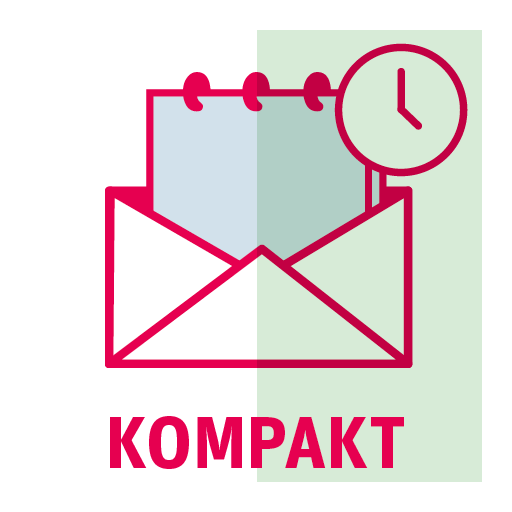
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Auch Russland hat seine Präsenz in der Antarktis verstärkt, Stationen modernisiert und wiedereröffnet und eine Landebahn gebaut. Konfliktfelder sind russische seismische Untersuchungen, Geoengineering-Pläne und illegale Fischerei.
US-Rückzug gefährdet Führungsrolle
Diese Dynamik trifft auf eine Schwächephase der westlichen Forschung. Laut einer internationalen Studie erreichte die Zahl der globalen Publikationen zu Antarktis und Südlichem Ozean 2021 ihren Höhepunkt – seither sinkt sie kontinuierlich. Besonders betroffen sind Australien und die USA. Laut der Antarktisforscherin Elizabeth Leane von der University of Tasmania und Keith Larson, Direktor des Arctic Centre an der Umeå University, weist dies »auf einen gefährlichen Rückzug aus der Antarktisforschung hin« – ausgerechnet in einer Zeit, in der sie dringender denn je gebraucht werde.
Unter der Trump-Regierung drohen den USA drastische Einschnitte. Das Budget der National Science Foundation soll 2026 um über 55 Prozent sinken. Auch die National Oceanic and Atmospheric Administration muss mit weniger Mitteln auskommen, der Vertrag für den Eisbrecher »Nathaniel Palmer« wird nicht verlängert.
Evan Bloom, früherer US-Diplomat und langjähriger Leiter der US-Antarktispolitik, warnte gegenüber dem australischen Sender vor den Folgen: »Ein Rückzug der USA aus der Wissenschaft wird langfristig Einfluss und Führungsrolle in der Governance des Kontinents kosten.« Im Anarktisvertragssystem, dem heute 58 Staaten angehören, haben nur 29 Mitglieder Stimmrecht – und diese Macht hängt stark von wissenschaftlicher und logistischer Leistungsfähigkeit ab.
»Dual-Use-Technologien«
China und Russland sind zwar Vertragspartner, wurden jedoch zuletzt beschuldigt, den Schutz der Antarktis zu untergraben – etwa durch die Blockade neuer Meeresschutzgebiete oder restriktiverer Regeln für den Krillfang. Hinzu kommen Befürchtungen angesichts sogenannter Dual-Use-Technologien: Anlagen wie Teleskope oder Satelliten-Bodenstationen, die offiziell der Wissenschaft dienen, aber potenziell auch militärisch genutzt werden könnten.
China weist geopolitische Motive zurück und betont, seine Arbeit diene ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. James Chin, Asien-Experte an der University of Tasmania, zweifelt jedoch an den scheinbar selbstlosen Motiven Pekings. »Die Chinesen gehen seit den vergangenen Jahren nicht nur in der Antarktis, sondern auch in der Arktis so vor«, sagte er bereits Anfang des Jahres in einem Interview. Hauptziel sei es, sicherzustellen, dass sie in einer sehr starken Position seien, um von der Mineralienausbeutung in der Arktis und Antarktis zu profitieren, sobald diese erlaubt werde. Peking wolle die antarktische Präsenz aber auch als geopolitischen Vorteil für sich nutzen.
Mangelndes Interesse
Auch für Australien selbst gewinnt die Antarktis zunehmend sicherheitspolitische Dimensionen. Umweltminister Murray Watt sprach kürzlich von einem »Contested Space« – einem umkämpften geopolitischen Raum, in dem Canberra seine Interessen aktiv vertreten müsse. Vor diesem Hintergrund wäre für Australien die Zusammenarbeit mit den USA noch einmal wichtiger. Denn gemeinsame Logistik macht die Arbeit in den entlegenen Regionen kostengünstiger und sicherer.
Sollte Washington seine Präsenz reduzieren und China oder Russland die Lücke füllen, wäre das für Canberra nicht nur eine Frage der Wissenschaft, sondern auch der nationalen Sicherheit.
Während sich die Großmächte in der Antarktis strategisch positionieren, gerät die eigentliche Dringlichkeit leicht in den Hintergrund: Die Region ist nicht nur ein geopolitisches Schachbrett, sondern auch ein entscheidender Kipppunkt im globalen Klimasystem. Schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel und bedrohte Ökosysteme machen deutlich, dass jede Verzögerung im internationalen Engagement einen hohen Preis hat.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.







