- Kultur
- China
Shenzhen: In freundlicher Umgebung
Soll das die Hölle sein? Eindrücke aus der jungen chinesischen Metropole Shenzhen

Gefährlich sind die zahlreichen Elektroroller, denn das Lärmproblem ist gelöst. Kaum hörbar schnurren sie von rechts und links heran; und wer hinter ihren Bewegungen kein Muster erkennt, tut gut daran, sich auf der Straße und selbst auf Gehwegen stets in alle Richtungen umzublicken.
Wo befinden wir uns? In Shenzhen, nach westlichen Vorstellungen unter allen chinesischen Überwachungshöllen der höllischsten. Die Einwohner freilich scheinen das noch nicht bemerkt zu haben. Es stimmt ja: Ihre biometrischen Merkmale sind erfasst, und überall hängen Kameras. Das aber hindert manche von ihnen nicht daran, bei Rot die Straße zu überqueren; und sollte es für die Mopedfahrer überhaupt Regeln geben, werden sie offenkundig weder eingehalten noch durchgesetzt.
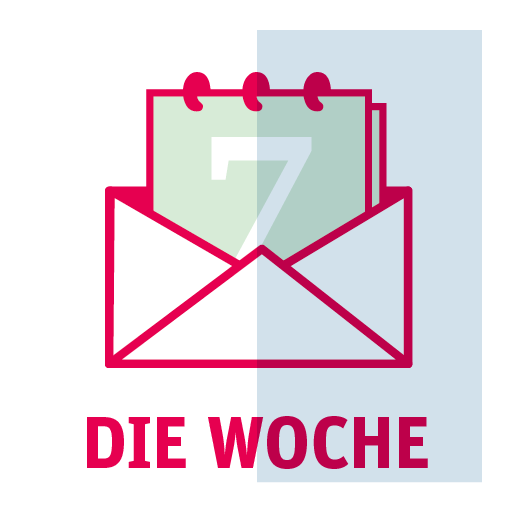
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Sehr vereinzelt wird gebettelt. Bei allem Wachstum hat China erst vor sehr kurzer Zeit absolute Armut beseitigt und ordnet sich selbst als Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand ein. Noch nicht alle wurden da mitgenommen. Immerhin sind die chinesischen Bettler nicht solche völlig zerrütteten Elendsgestalten, wie sie oft durch Berliner U-Bahnen wanken. Sie sind einfach gekleidet, doch nicht abgerissen, und haben auch keine offenen Wunden.
Es scheint ein gewisses Maß an funktionierender Fürsorge zu geben und jedenfalls keine Repression. Offenkundig wird die durchaus vorhandene Überwachung als Möglichkeit eingesetzt, groben Verstößen vorzubeugen und sie gegebenenfalls zu ahnden. Im Kleinen werden die Regeln flexibel gehandhabt.
Grundlage dieser Behauptungen ist die erste von mehreren geplanten Leserreisen der sozialistischen Wochenzeitung »UZ«. Sie führte im chinesischen Osten durch die Großstädte Beijing, Tianjin, Shanghai und eben Shenzhen. Vier Metropolen lassen sich natürlich nicht in neun Tagen gründlich erschließen. Immerhin erklärte auf jeder dieser Stationen ein chinesischer Reiseleiter nicht nur die Sehenswürdigkeiten, sondern erzählte auch über Errungenschaften und Probleme des Alltagslebens. Da ging es etwa um bezahlbaren Wohnraum oder um horrende Kosten für eine konkurrenzfähige Ausbildung der Kinder.
Verängstigt wirkten die Reiseleiter jedenfalls nicht, und sie sprachen mehr Schwierigkeiten an, als ein Berlin-Tourist sie auf einer Spree-Flussfahrt hören würde. Deng Xiaoping formulierte zur Begründung der Reformen in der Post-Mao-Zeit, zuerst müssten einige reich werden, damit später alle reich seien. Das Konzept, Kapitalisten für den Aufbau des Sozialismus einzusetzen, führte zu Erfolgen und dabei zu einer ökonomischen Ungleichheit. Die chinesische KP hat dieses Problem erkannt und wirkt dem insbesondere in der Zeit Xi Jinpings seit 2012 effizient entgegen.
Doch Statistiken sind keine Eindrücke eines Reisenden. Zu sehen war in Beijing im 2021 zum 100. Gründungstag eröffneten Museum zur Geschichte der Kommunistischen Partei, dass Deng Xiaoping eine zentrale Position einnimmt. Mao als die bestimmende Figur der ersten 27 Jahre der Volksrepublik erscheint auf kaum einem Foto alleine. Deng ist verglichen damit deutlich aufgewertet.
Shenzhen hat ein Museum für Stadtentwicklung, auch dort ist Deng präsent. Das überrascht nicht, denn die Stadt ist praktisch eine Neugründung von 1980. Damals lebten in der Gegend knapp 60 000 Menschen, jetzt sind es fast 18 Millionen. Standortvorteil war aus Sicht der chinesischen Reformer die Nachbarschaft zu Hongkong, damals noch britische Kolonie. Mit der Gründung einer Sonderwirtschaftszone sollte Kapital aus Hongkong angezogen und für die Entwicklung der Wirtschaft nutzbar gemacht werden. Im Eiltempo veränderte sich der Status von Shenzhen in der globalen Ökonomie. Am Beginn stand arbeitsintensive Billigproduktion. In der Gegenwart sind die Produkte technologisch fortgeschritten – Huawei hat in der Stadt einen wichtigen Standort. Auch Forschung und Entwicklung sind präsent.
Auf dem Reiseprogramm stand ein Besuch bei der BGI Group, wobei das Kürzel für Beijing Genomics Institute steht. Der Name zeigt die Herkunft der Firma. Sie wurde 2007 aus einer staatlichen Institution in der Hauptstadt herausgelöst und nach Shenzhen verlegt. Dies verweist auf die Zuversicht bereits vor zwei Jahrzehnten, in der Sonderwirtschaftszone ein Wissensnetzwerk vorzufinden, das für die Forschung förderlich ist.
Eine so neue Stadt muss besonders neu aussehen, so jedenfalls die Erwartung. Ganz wurde sie nicht erfüllt. Natürlich prunken manche Museen mit futuristischer Architektur, und es gibt neben ungeheuren Anhäufungen an Wohnhochhäusern ein stattliches Geschäftszentrum mit individuell gestalteten Glastürmen. Überragt werden sie vom Ping An International Finance Center, von dessen 562 Meter hoher Aussichtsetage sich die halb so hohen Nachbargebäude kümmerlich ausnehmen und die etwas weiter entfernten zehnstöckigen Wohnhäuser wie Spielzeugklötzlein. Nur, der Blick war nicht von deutschen Gewohnheiten, sondern vom zuvor Gesehenen geprägt.
Beijing ist eine ausgedehnte Hochhausgegend. Nur an wenigen Stellen finden sich Einsprengsel: alte Paläste und Parks, Monumentalgebäude aus den 50er Jahren und nur wenige jener alten Gassen, deren Verschwinden jene westlichen Touristen bejammern, die in solch einfach ausgestatteter Gegend niemals auf Dauer wohnen wollten.
Tianjin und Shanghai waren koloniale Vorposten, und tatsächlich sind in beiden Städten noch einige europäisch wirkende Straßenzüge erhalten. Rundherum ist alles neu und in der Bauhöhe, die naheliegend ist, wenn man nicht mit 1,4 Milliarden Menschen das Land zersiedeln will. In Shanghai war vom Bus aus zu sehen, wie gerade ein paar letzte Altbauten abgerissen wurden, also Gebäude, die, großzügig gerechnet, mehr als 30 Jahre alt sind.
Warum wird man nicht angerempelt?
-
Weil Shenzhen im Ganzen so neu ist, ist es in äußeren Bezirken, wo der Bodenpreis nicht so hoch liegt, vergleichsweise alt. So kann man sich noch durch Straßen aus der ersten Phase des Stadtaufbaus bewegen. Ein geradezu labyrinthisches Kaufhaus hat überlebt, vier Etagen mit winzigen Einzelgeschäften, in denen man feilschen kann. Viele Kunden kommen aus Hongkong, wo die Preise deutlich höher sind.
Verhandelt wird freundlich, die Händler drängen sich kaum auf. Überhaupt – nicht nur in Shenzhen – fiel auf, dass sogar dort, wo Massen von Menschen aufeinandertreffen, jegliche Aggressivität fehlt. Kommt man aus Berlin, so fragt man sich: Warum wird man nicht angerempelt? Wo ist die an den Verhältnissen verrückt gewordene Person, die auf einer Bank sitzt und irre Sätze in eine genervte Welt schreit? Warum kommen in China die Polizisten ohne bürgerkriegsartige Kampfmontur aus, werden von Einheimischen vertrauensvoll gefragt und geben ruhig Antwort? Angst und Unterdrückung sehen anders aus.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.






