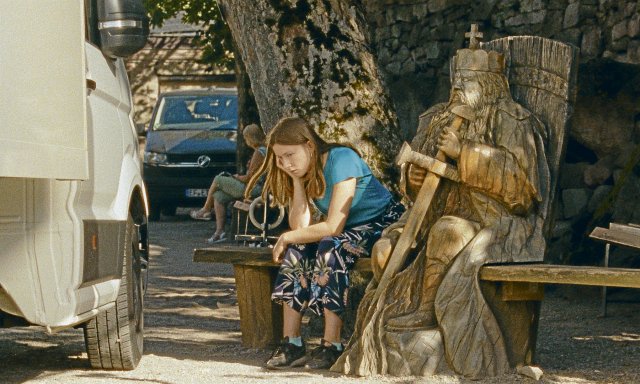- Kultur
- Museum Barberini
Bitte nicht anfassen: Einhörner in Potsdam
Das Bürgertum und seine Einhörner: Das Museum Barberini in Potsdam widmet sich einem popkulturellen Phänomen – und weicht ihm aus

Wenn man sein Wochenende mit einer Vierjährigen im Glitzershirt planen muss, wirkt diese Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini wie ein Muss: Kunst mit Niveau und trotzdem Einhörner. Doch leider ist die Schau »Einhorn. Das Fabeltier in der Kunst« ein gutes Beispiel dafür, was im deutschen Museumswesen schiefläuft. Kinder kommen selbst da nicht vor, wo das Thema kindlicher kaum sein könnte, Popkultur wird mit der Zange nicht angefasst, Gegenwartsbezug aus kuratorischer Ehrfurcht vermieden. Die Ausstellungsdidaktik nach dem Schema »Bild im Rahmen mit Erklärtext« stammt aus Kaisers Zeiten.
Meine Tochter, die Einhörner liebt und von diesen fast so viele künstlerische Repräsentationen besitzt, wie das Barberini in seinen Hallen zeigt, fand dort abgedunkelte Räume, ehrfürchtige Stille und Bilder, von denen man aus 1,20 Meter Höhe nur den unteren Rand des Goldrahmens sehen konnte. Außer dem goldenen Treppengeländer gab es nichts, was man anfassen durfte. So kam es, wie es kommen musste. Nach dem dritten Bild werde ich angemault: »Ich will nicht nur Bilder angucken.« Den im Foyer angekündigten Audioguide für Kinder gibt’s leider nur als App fürs Handy. Anscheinend gehen die Macher davon aus, dass Kinder im Einhorn-Alter über ein Smartphone verfügen.
Kurz entschlossen parke ich die Kleine und ihren Bruder vor einem Lehrfilm: Talking Heads älterer Damen und Herren erklären auf Englisch mit Untertiteln Einhornbilder. Für die Kleinen völlig unverständlich, doch die Bewegtbilder entfalteten ihre gewohnt lähmende Wirkung und verschaffen mir einen Moment Luft. Während einer der Redeköpfe über Plüschtierproduzenten schimpft, die Einhörner ins Kinderzimmer bringen (kein Witz!), verabrede ich schnell eine neue Arbeitsteilung mit meiner Partnerin: Ich darf nach dem Film eine halbe Stunde Kunst gucken, während sie die Kinder in die Cafeteria entführt. Dort ändert sich die Ansprache sofort: »Es gibt auch Chicken McNuggets«, erklärt eine Kellnerin freundlich. Es wären so viele Kinder wie nie in der Ausstellung – da habe man das eben auf die Karte genommen.
In meiner komprimierten kinderfreien Museumsrunde lerne ich dann in 30 Minuten einiges über Einhörner – die Ausstellung ist durchaus beeindruckend. Gemälde, Skulpturen, Installationen seit dem ausgehenden Mittelalter, Kuriositäten wie jene Narwalzähne, die in vergangenen Zeiten als Hörner des Fabeltiers horrende Preise erzielen. Auch Ironisches ist dabei, etwa Arnold Böcklins »Das Schweigen des Waldes« aus dem Jahr 1885 mit einem Einhorn, das eher einer Kuh gleicht – ein ironischer Kommentar zur mystischen Romantik seiner Zeit. Man lernt einiges über die Genese des Mythos: von ersten Auftritten in den Naturbeschreibungen des Plinius über eine chinesische Parallelüberlieferung mit schuppigen, drachenähnlichen Einhörnern.
Das Einhorn in der Bibel wird erwähnt – doch spätere Online-Recherche belehrt mich über eine Fehlübersetzung: Eigentlich beschreibt das hebräische Wort »re’em« einen Auerochsen. Der Patzer inspirierte Jahrhunderte christlicher Kunst: Einhörner durchstreifen den Garten Eden, besteigen die Arche Noah und liegen der Jungfrau Maria zu Füßen – als Symbol christlicher Keuschheit, wird erklärt. Trotz oder wegen ihres phallusförmigen Horns, frage ich mich.
Die Ausstellung aber fragt so unanständige Dinge nicht. Obwohl sie nichts für Kinder ist, gibt es keinen Sex. Das Mittelalter mit seinen Diskursen über Keuschheit und Reinheit sickert durch die Erklärspalten, mehrfach wird bemerkt, dass nur Jungfrauen Einhörner zähmen können. Die Auseinandersetzung mit der verdrängten Sexualität hinter dieser fixen Idee bleibt dem Betrachter überlassen. Das Einhorn im Patriarchat? Ein Thema für feministische Blogs, nicht fürs Barberini.
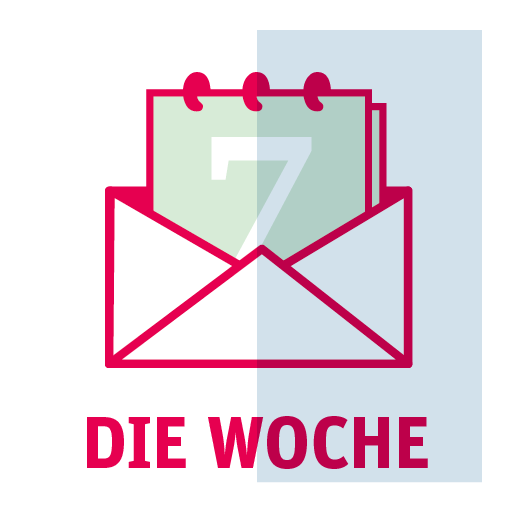
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Die Talking Heads im Lehrfilm erwähnten immerhin das Einhorn in der queeren Szene. In den Exponaten findet es sich nicht, das Schwule und Schwülstige, das Schwitzige, das Queere und Tierische in uns, das gute und schlechte Kunst gleichermaßen inspiriert. Die Ausstellung meidet alles Störende: Kinder stören, Sex und Feminismus stören, und eigentlich stört auch die Gegenwart mit ihren Konflikten. Die überwältigende Mehrheit der Exponate stammt aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg – irgendwann um 1917 muss etwas passiert sein, das das Bürgertum furchtbar erschreckt hat.
Einige Ausnahmen aber gibt es – ein Performance-Video von Rebekka Horn aus dem Jahr 1970, als Hingucker die kunstfellige und dennoch täuschend echte Installation eines lebensgroßen schwarzen Einhorns mit Körpertemperatur von 43 Grad (nicht anfassen!). Doch wo ist die Popkultur? Was ist mit dem Filmklassiker »Das letzte Einhorn« (1982) und dem Song »The Last Unicorn« der Band America? Wo sind die Glitzershirts, Graphic Novels, Stofftiere, Regenbogen-Einhorn-Malbücher? Fehlanzeige.
Was hätte man mit diesem Material alles machen können? Die ganze Didaktik dieses Kunsttempels umkrempeln zum Beispiel: Mal- und Bastelstationen für die Kinder, Plüsch-Installationen zum Beklettern, einen Kostüm- und Cosplay-Wettbewerb für Groß und Klein. Oder auch mal was Kritisches über Infantilisierung und Harmoniesucht in der Popkultur. Kurzum: Mitmach-Angebote, die Kunst vom Sockel holen, Kinder und Erwachsene, Gegenwart und Zukunft verbinden. Stattdessen Vergangenheit zum Nichtanfassen. Immerhin gibt es an einigen Samstagen Kinder-Seminare – ehrenwert, aber Addition zur angestaubten Didaktik.
Kurz vorm Gehen finde ich es doch, das Einhorn von heute. Versteckt in einer Ecke. Oliv und blau, vielleicht zehn Zentimeter groß und das jüngste Objekt, das ich entdecken konnte. Es ist ein Militärabzeichen, entworfen um 2020: ein brüllendes Einhorn, laut Infobox getragen von queeren Angehörigen der ukrainischen Armee. Im militärischen Gewand haben die Moderne und ihre Gebrauchsgegenstände dann doch künstlerischen Rang.
»Einhorn. Das Fabeltier in der Kunst«, bis 1. Februar, Museum Barberini, Potsdam.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.