- Politik
- Brustkrebs und Feminismus
Reyhan Şahin: »Der Frauenkörper ist immer noch ein Tabu«
Ein Gespräch mit Reyhan Şahin auch bekannt als Hip-Hop-Künsterlin Dr. Bitch Ray, über Brustkrebs und Empowerment

Was hätten Sie gerne gewusst, bevor bei Ihnen Brustkrebs diagnostiziert wurde?
Es gibt ganz viele Sachen, die ich eigentlich gerne vorher gewusst hätte. Mit Krebs beschäftigt man sich erst, wenn man ihn selbst hat. Es gibt vieles, was man sich auch nicht anlesen kann. Ich dachte zum Beispiel vorher, Metastasierungen seien immer tödlich. Das kann sein, muss aber nicht. Die Brustkrebsforschung ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass das mithilfe von bestimmten Medikamenten gemanagt werden kann. Ich wusste auch nicht, was eine pathologische oder sonografische Komplettremission ist. Eine pathologische bedeutet, dass die Chemotherapie sehr gut anschlägt und der Tumor sozusagen weggeätzt wird. Und wenn die Krebszellen im ganzen Körper beseitigt wurden, spricht man von einer pathologischen Komplettremission. Ich wollte das in Umgangssprache, leicht verständlich und personalisiert, angelehnt an meine Krankheitsgeschichte, unter die Menschen bringen.
Als Rapperin Lady Bitch Ray sind Sie bekannt dafür, sehr offen über Sexualität, übers Frausein und weibliche Lust zu sprechen. Ist Brustkrebs auch ein Tabuthema?
Auf jeden Fall. Bestimmt wird im Vergleich zu vor zehn oder 20 Jahren mehr darüber gesprochen, keine Frage. Aber der Frauenkörper ist immer noch ein Tabuthema. Brustkrebs hängt auch mit weiteren solchen Themen zusammen, wie zum Beispiel Fehlgeburten, Abtreibungen, Kinderwunsch, Älterwerden, Sexualität, Körpernormen, »Schönheit« und dem »Male Gaze«, dem männlichen Blick. Frauen und nicht-binäre Personen sind einem enormen gesellschaftlichen, patriarchalisch geprägten Druck ausgesetzt, dünn zu sein und »gut« auszusehen. Ich habe das Gefühl, Brustkrebs ist mal wieder ein Tabuthema, das ich auf meine Weise brechen muss.
Wen wollen Sie damit erreichen?
Ich wollte meine Geschichte erzählen und damit Frauen und andere Betroffene sowie ihre Angehörigen ermutigen, empowern, ihnen Tipps geben. Aber das Buch ist nicht nur für sie geschrieben. Brustkrebs geht alle etwas an. Heutzutage erkrankt jede siebte bis achte Frau daran, Tendenz steigend. Das heißt, es ist auch ein Buch für alle, die denken: »Das wird mich nicht treffen.« Potenziell kann jede Frau betroffen sein – und auch einige Männer bekommen Brustkrebs. Um das zu verhindern, sollte man zu den jährlichen Vorsorgeuntersuchungen gehen. Man sollte sich abtasten.
Reyhan Şahin ist auch als Rapperin Dr. Bitch Ray bekannt. Geboren wurde sie in Bremen. Sie ist Sprach-, Migrations-, Islam- und Rassismusforscherin, politische Aktivistin, Bildungsreferentin, Rapperin, Performance-Künstlerin, Schauspielerin, Modemacherin und Autorin. In dem Buch »Amazonenbrüste« schreibt sie über ihre Brustkrebserfahrung.
Der Titel »Amazonenbrüste« bezieht sich auf die Vorstellung, dass sich die Amazonen aus der griechischen Mythologie eine Brust amputieren ließen, damit sie besser mit Pfeil und Bogen schießen konnten. Haben Sie hier eine positive Umdeutung vorgenommen, so wie mit dem Begriff »Bitch«?
Ja, es ist ähnlich. Der Unterschied ist, »Bitch« war früher wirklich eine Beleidigung. Vor allem im Rap wurde der Begriff verwendet, um die Sexualität der Frau aus patriarchalischer Perspektive abzuwerten. »Amazonenbrüste« ist nicht per se negativ konnotiert. Aber ich habe dieses Wort in Anlehnung an die griechische Mythologie geschaffen, weil es Parallelen zu mir und meinem Körper gab. Bei mir war auch die rechte Brust betroffen. Außerdem sollen die Amazonen im heutigen anatolischen Teil der Türkei gelebt haben. Da kommen meine Eltern her. Anlässlich dieser Verbindungen habe ich gedacht, das hat etwas mit Selbstermächtigung, mit einer Art Reclaiming zu tun. Sprache spielt für mich als Rapperin und als Sprachwissenschaftlerin eine ganz große Rolle. Während der Krebserkrankung habe ich eine Art von Sprachlosigkeit gespürt, die auch mit Scham verbunden war. Auch für mich war es ein Prozess, bis ich darüber sprechen und das Thema positiv besetzen konnte. Damit meine ich nicht, dass die Krankheit positiv ist, aber es gibt inzwischen viele Behandlungsmöglichkeiten und auch der gesellschaftliche Umgang ist viel normaler geworden. Ich möchte diese Sprachlosigkeit aufbrechen und eine positive Haltung entwickeln.
Sie beschäftigen sich schon lange mit Weiblichkeit, Lust und Sexualität. Hat die Krebserkrankung Ihren Blick auf diese Themen verändert?
Vielleicht bin ich durch den Krebs noch radikaler in meiner intersektionalen, feministischen Sichtweise. Wenn Existenzielles auf dem Spiel steht, verändert sich einiges. Die ersten drei Monate waren grausam, ich war in Schockstarre. Ich habe Notizen gemacht, aber ich hatte noch keine Sprache für all das, was passiert – und schon gar keinen Humor. Im Buch beschreibe ich, wie ich im Wartezimmer sitze und diese gestreiften Chemotherapie-Mützen sehe, die ich so potthässlich finde, weil sie nach Krebs und Tschernobyl aussehen. Gleichzeitig sage ich: »Alter, wie bescheuert bin ich denn?« Mein Leben steht auf dem Spiel und ich mache mir Sorgen um Mützen. Es geht also wieder um mein Aussehen. Trotz dritter und vierter postfeministischer Welle habe ich nichts gelernt. Wenn es um Leben und Tod geht, ist doch scheißegal, wie man aussieht. Aber es hat mir auch gezeigt, dass man an einem Stück Normalität festhalten kann, wenn man sich Gedanken ums Aussehen macht. Der Körper ist ja auch ein Zeichen für Vitalität und Leben. Wenn man Sport machen kann und gesund ist, hat das nichts mit dem Male Gaze zu tun, man macht das für sich selbst. Was mir in Sachen Body Positivity und mit dem eigenen Körpergefühl sehr geholfen hat, war das Krebstagebuch von Audre Lorde, das sie in den 80ern geschrieben hat. Es ist sehr traurig, aber auch sehr empowernd, wie sie mit ihrer abgenommenen Brust umgegangen ist. Sie hat sie flach getragen. Ich weiß nicht, ob ich das auch gemacht hätte. Bei mir konnte die Brust, Göttin sei Dank, erhalten werden.
In dem Buch bringen Sie unterschiedliche Facetten Ihrer Identität und Biografie ein: Musikerin, Wissenschaftlerin, Tochter von Gastarbeiter*innen. Welche Rolle spielen diese Aspekte als Brustkrebs-Patientin im Gesundheitssystem?
Im Gesundheitssystem war ich schon durch meine schweren Depressionen gelandet, die ich vor zehn und 20 Jahren hatte. Darin war ich geübt. Die Mehrfachidentitäten als Wissenschaftlerin, Schriftstellerin, Aktivistin, Rapperin, Bildungsreferentin, Designerin waren schon länger ein Thema in meiner Psychotherapie – weil das gesellschaftlich teilweise gar nicht anerkannt wurde. Als ich damals als Lady Bitch Ray berühmt wurde, waren meine Herkunft und meine Tätigkeit als Doktorandin Thema Nummer eins. Es ging wenig um meine Musik. Wenn, dann wurde sie skandalisiert und aufs Sexuelle reduziert. Das Feministische wurde weitgehend ausgeblendet. Es ging viel um meine Herkunft und Fremdzuschreibungen: »Was sagen denn deine Eltern dazu?« Davon sind heutige Rapperinnen komplett befreit. Das kann eine Errungenschaft sein, andererseits ist es schon ein Unterschied, ob ein Gastarbeiterkind und eine muslimisch sozialisierte Alevitin Sex-Rap macht oder eine weiße Frau mit Migrationsdefizit. Für mich war das alles damals nicht so einfach – und sogar lebensbedrohend. In dem Buch versuche ich, meine verschiedenen und als widersprüchlich wahrgenommenen Identitätsanteile zusammenzubringen. Weil sie zusammengehören.
Sie haben als Rapperin und Doktorandin massiv unter Anfeindungen gelitten. So sehr, dass Sie Ihre musikalische Karriere der Wissenschaft geopfert haben?
Ja, ich musste aufhören. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie das vor fast 20 Jahren war. Ich wollte schon immer Rapmusik machen, das war meine Leidenschaft. Zu diesem Zeitpunkt stand mir alles offen. Aber mein akademisches Umfeld konnte mich nicht schützen. Das hat mich dazu gebracht aufzuhören. Das hört sich heute vielleicht unglaubwürdig an, aber es ist die Wahrheit. Das ist für mich als Künstlerin ziemlich verletzend.
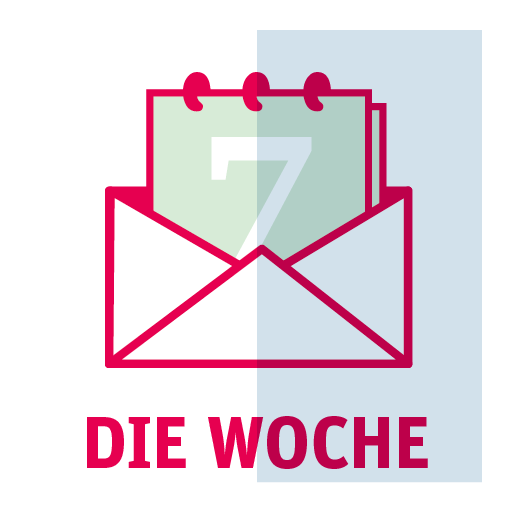
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Im Buch berichten Sie über Ambitionen, wieder Rapmusik zu machen. Warum ist das so schwer?
Das Hauptproblem in der Deutschrapszene ist, dass die chauvinistischen, sexistischen Männer jetzt auch entdeckt haben, dass man mit emanzipatorischem Sex-Rap Geld verdienen kann. Sie sind die Strippenzieher hinter vielen dieser neuen Rapperinnen. Noch krasser als unsere Gesamtgesellschaft ist diese Szene durch und durch sexistisch geprägt, es ist ein Ort der Rape Culture. Als Feministin ist es eine echte Herausforderung, Sex-Rap zu machen. Aber ich gebe mein Bestes.
Ist das die Ankündigung eines Comebacks?
Ich sage nur: Gnade euch die Göttin der Gerechtigkeit, wenn ich es schaffe, geeignete Produzent*innen zu finden, um meine musikalische Vision umzusetzen. Der Titel »Amazonenbrüste« schreit ja schon danach, daraus einen Song zu machen. Mehr will ich dazu nicht sagen.
Reyhan Şahin: »Amazonenbrüste. Wie ich den Brustkrebs bekämpfte«. Tropen Verlag, 240 S. br., 18€.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.






