- Politik
- Gewerkschaften
Belgien: Alle gemeinsam gegen »Arizona«
Ein Generalstreik setzt die Koalitionsregierung von Bart de Wever in Belgien unter Druck

Hunderte Schiffe, die vor den belgischen Häfen auf Abfertigung warten. Industriegebiete überall in Flandern und der Wallonie blockiert. Die Hallen der Flughäfen und Bahnhöfe leer. Fitnessstudios, Supermärkte, Schulen, Krankenhäuser geschlossen. Müll, der nicht abgeholt wird. Pakete, die nicht geliefert werden. Selbst die internationalen NGOs der Brüsseler EU-Blase waren am Mittwoch im Streik, dem vorläufigen Höhepunkt der größten Streikwelle in Belgien im 21. Jahrhundert.
Sie richtet sich gegen Belgiens »Arizona«-Regierung, die nach der vierfarbigen Flagge des US-Bundesstaates benannt ist und sich aus sieben konservativ-liberalen, sozial- und christdemokratischen Parteien zusammensetzt. Seit ihrem Amtsantritt vor einem Jahr versucht die Regierung, das nach wie vor starke belgische Sozialmodell zu schwächen. Die Gewerkschaften sprechen vom größten Rückschritt für die Arbeitnehmerrechte, seit sie 1946 im Rahmen des Nachkriegs-Sozialpakts dem Kapital erhebliche Zugeständnisse abgerungen hatten.
Im Fahrwasser des allgemeinen europäischen Rechtsrucks gewannen rechte Parteien bei den Wahlen in Belgien im vergangenen Jahr in Flandern und der Wallonie die Mehrheit. Die größten Regierungsparteien sind die flämisch-nationalistische N-VA und die nicht mehr ganz so liberale wallonische MR, unterstützt von den zentristischen Les Engagés sowie der flämischen sozialdemokratischen Vooruit. Sie hielten das flämische Äquivalent der AfD, den aufstrebenden rechtsextremen Vlaams Belang, von der Macht fern und bildeten Koalitionen auf regionaler und föderaler Ebene.
Die Streikwelle der vergangenen Tage hat selbst langjährige Gewerkschafter überrascht.
Ganz im Sinne der Europäischen Kommission, die eine Erhöhung der »Wettbewerbsfähigkeit« und den Abbau von Haushaltdefiziten fordert, schlug die belgische Regierung nun umfassende neoliberale Reformen der Arbeitsgesetzgebung, der Renten und der Arbeitslosenversicherung vor. Dabei soll das Rentenalter auf 67 Jahre erhöht und der Arbeitsmarkt dereguliert werden. Dazu kommen Sparmaßnahmen von fast zehn Milliarden Euro.
Mit den Streiks der letzten Tage ist es den Gewerkschaften nun jedoch gelungen, Teile der Regierungsagenda zu blockieren und zu zeigen, dass die organisierte Arbeiterschaft noch immer erheblichen Einfluss hat. Die Gewerkschaften haben seit Anfang des Jahres schrittweise eskaliert. Im Januar streikten 30 000 Lehrer*innen, im Februar nahmen 100 000 Menschen an einer zentralen Demonstration in Brüssel teil, im März gab es den ersten Generalstreik, danach mehrere regionale und sektorale Aktionen sowie im Oktober eine weitere zentrale Demonstration mit 140 000 Teilnehmern – die größte im 21. Jahrhundert in Belgien.
Höhepunkt der Mobilisierung war diese Woche nun der dreitägige Streik der drei gewerkschaftlichen Dachverbände – der sozialistischen FGTB, der christlichen CSC und der liberale CGSLB. Auf den Ausstand im Transportwesen folgte am Dienstag ein Streik im öffentlichen Dienst und am Mittwoch schließlich ein landesweiter Generalstreik.
Kurz vor den Arbeitskämpfen kündigte die Regierungskoalition nach 20 Stunden Verhandlungen an, eine Einigung für einen Austeritätshaushalt erzielt zu haben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Regierungsparteien aufgrund des Drucks der Gewerkschaften die Verhandlungen immer wieder abbrechen müssen. Premierminister Bart de Wever war schlussendlich sogar zum belgischen König gegangen und hatte mit dem Fall der Regierung gedroht.
Der Zeitpunkt der Ankündigung war nicht zufällig. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr gab die Regierung kurz vor einem Streik eine Absichtserklärung ab mit dem offensichtlichen Ziel, die Bewegung zu demobilisieren. Bis dato ist diese Strategie jedoch jedes Mal fehlgeschlagen.
Die Streikwelle der vergangenen Tage ist die größte Machtdemonstration der belgischen Arbeiterbewegung der vergangenen Jahrzehnte und hat selbst langjährige Gewerkschafter*innen überrascht. Wesentlich dafür war, dass es gelang, die drei Gewerkschaftsverbände, den privaten und öffentlichen Sektor sowie die Sprachgemeinschaften des Landes zusammenzuführen. Diese Einigkeit legte die Widersprüche zwischen den Regierungsparteien offen.

So steht die sozialdemokratische Vooruit unter Druck, die historischen Errungenschaften der Bewegung, aus der sie hervorgegangen ist, verteidigen zu müssen. Die rechte MR hat mit dem Versprechen einer höheren Kaufkraft durch niedrigere Einkommenssteuern Wahlkampf gemacht, aber nichts als sinkende Lebensstandards vorgeschlagen. Die Christdemokratie reagiert trotz ihrer geschwächten Verbindungen zur christlichen Arbeiterbewegung immer noch auf Druck in sozioökonomischen Fragen: Ein regionaler Lehrerstreik zwang sie in der französischsprachigen Wallonie zu einer Kehrtwende. Und mittendrin versucht der Premierminister Bart de Wever von der flämischen N-VA, das flämische Kapital zufriedenzustellen und gleichzeitig seine Koalition zusammenzuhalten.
Es gelang der Regierung, einige regressive Maßnahmen durchzusetzen wie beispielsweise die Begrenzung der Arbeitslosenversicherung auf zwei Jahre. Dadurch werden 160 000 Menschen ihre Leistungsbezüge verlieren. Da diese Leistungen größtenteils über die Gewerkschaften ausgezahlt werden – was ein wichtiger Grund für eine Mitgliedschaft ist –, stellt dies einen doppelten Angriff auf die organisierte Arbeiterschaft dar.
Nicht gelungen ist der »Arizona«-Regierung hingegen die Umsetzung der umstrittenen Rentenreform, die unter anderem die Anhebung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahren vorsieht. Das liegt auch daran, dass sich die Beschäftigten, anders als bei dem Thema der Arbeitslosenversicherung, in dieser Frage über berufliche, regionale und politische Grenzen hinweg einig sind. Vor allem brutale Sanktionen von bis zu 25 Prozent weniger Rente für diejenigen, die vorzeitig in Rente gehen wollen, haben für Wut und Widerspruch gesorgt. Diese Sanktion ist nun definitiv bis 2027 ausgesetzt. Die Bewegung hat auch durchgesetzt, dass Zeiträume, in denen man krank, arbeitslos oder schwanger ist, als Beitragsjahre in der neuen Rentenkalkulation zählen.
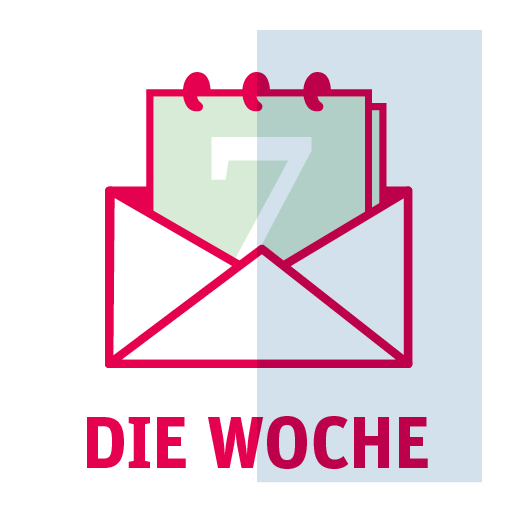
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Wie der Konflikt zwischen der organisierten Arbeiterschaft und der rechten belgischen Regierung ausgehen wird, ist noch unklar. Zum jetzigen Zeitpunkt weigert sich die Regierung, sich mit den Gewerkschaften auch nur an einen Tisch zu setzen. Marie-Hélène Ska, die Generalsekretärin des christlichen Gewerkschaftsbunds CSC, sprach während des Streiks von einem Aktions-»Marathon«, der in den kommenden Monaten weitergehen werde, wenn kein ernsthafter Dialog über Arbeitsbedingungen, schwere Arbeit und den Schutz der Kaufkraft aufgenommen würde.
Der Präsident der belgischen Partei der Arbeit, einer der wenigen aufstrebenden linken Parteien in Europa, gab sich auf einem Streikposten in seiner Heimatstadt Liège ebenfalls kämpferisch: »Ich möchte allen eine Botschaft der Hoffnung mitgeben: Es wurde noch nichts beschlossen. Der ›Malus Pension‹ [die oben genannte Sanktion, Anm. d. Red.] wurde dank des gesellschaftlichen Drucks bereits um ein Jahr verschoben. Das beweist, dass sich Engagement lohnt. Wir werden nicht aufgeben. Wir können diese Regierung stoppen.«
Eins scheint klar: Durch die einjährige Streikwelle sind zwischen Gewerkschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft neue Verbindungen entstanden, Hunderte von gewerkschaftlichen Führungspersonen wurden ausgebildet, Tausende junge Menschen in die Bewegung gebracht. Zudem haben Hunderttausende gelernt, wie man streikt und Millionen Menschen über die unsoziale Agenda der Regierungsparteien aufgeklärt.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.






