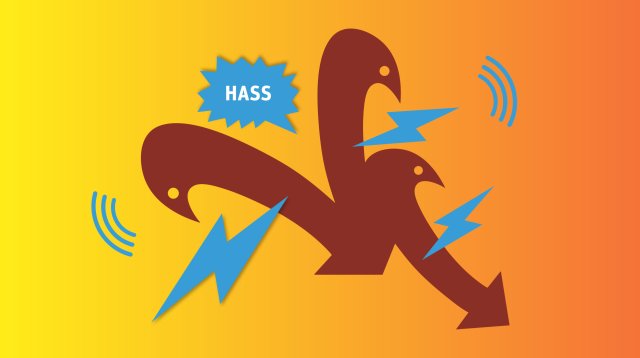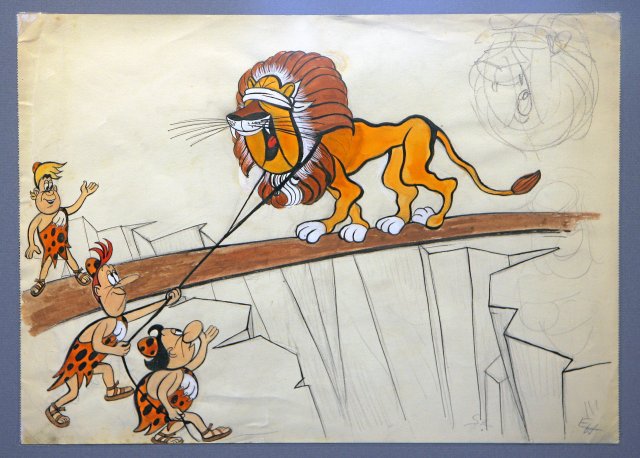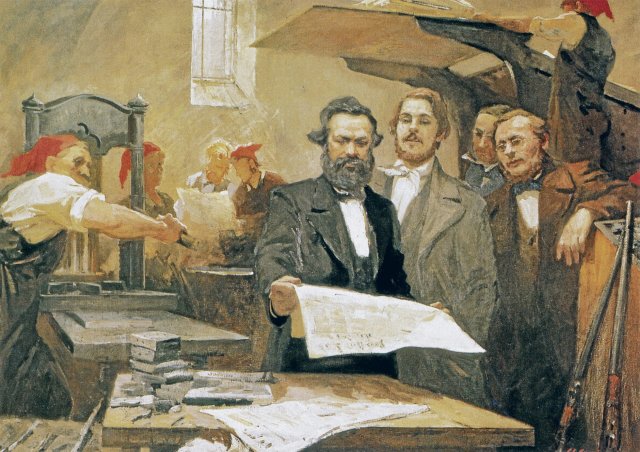Die »Laternenkinder« von Rudolf Bartels
Die Schwaaner Kunstmühle: Das Worpswede Mecklenburgs
Es gibt ein Foto von Rudolf Bartels aus dem Jahre 1940, da sieht man den Maler vor einem Porträt des Rostocker Lehrers und Kunstsammlers August Burmeister. Eine Staffelei kann er sich nicht leisten, das Bild steht auf einem Stuhl ihm gegenüber. Bartels, der 1933 wegen Verweigerung des Hitlergrußes für sechs Wochen eingesperrt wurde, ist – neben Alfred Heinsohn – derjenige mecklenburgische Maler, der bereits kurz nach der Jahrhundertwende mit seinen Bildern Anschluss an die europäische Moderne findet.
Jedoch passiert dies an einem Ort, auf den die Welt nicht schaut: Mecklenburgs Worpswede liegt an der Beke und ist eine verschlafene Ackerbürgerstadt. Um 1900 beginnt hier der Geist des Neuen zu atmen. Die Idee einer Künstlerkolonie, wie sie seit den Freiluftmalern von Barbizon Mitte des 19. Jahrhunderts den Kunstbegriff revolutionierte. Wahre Kunst ist nicht akademisch, sondern existenziell! Wieso Schwaan? Weil sie hier geboren worden waren – der Gründer der Kolonie, Franz Bunke (1859), Rudolf Bartels (1872) und sein Bruder Otto (1874), Peter Paul Draewing (1876). Nur Alfred Heinsohn stammt aus Hamburg und lebt von 1902 bis 1915 in Schwaan. Bunke ist der arrivierteste unter ihnen, er bringt es bis zum Professor in Weimar und zum Ehrenbürger seiner Geburtsstadt. Er ist der einzige von den Schwaanern, der seine Bilder in nennenswertem Umfang verkauft. Will man die Worpswede-Analogie bemühen, was nicht abwegig scheint, so kann man auch hier eine Teilung der Gruppe in eine konservative und eine progressive Richtung beobachten. Was in Worpswede Mackensen und Hans am Ende waren (»Mackensen und Konsorten« nennt sie Paula Modersohn-Becker), das sind hier Bunke und Draewing. Biedere erdverbundene Gestalten. Was für Worpswede Heinrich Vogeler und Paula Modersohn-Becker sind, dazu werden in Schwaan Rudolf Bartels und Alfred Heinsohn. Leider sind sie bis heute kaum bekannt geworden, dafür lebten und arbeiteten sie zu sehr im Abseits – und für ihre Kunst gab es im Mecklenburg vor dem Ersten Weltkrieg kein Publikum.
Heinsohn malt auf Sackleinen, mal nur mit schwarzem Pinselstrich, der leere Flächen schreien lässt, mal mit grellen Farben und mutig bis ins Kenntliche deformierten Formen. Mein Lieblingsbild: »Zwei Kühe« von 1920. Zwei in der Geometrie ausgesetzte Rindviecher, die man hier nicht anders nennen kann, weil ihnen diese Rechnung sichtlich zu hoch ist – zumal sie selbst von der Analyse betroffen sind. Dies wäre ein Bild nach Pablo Picassos Geschmack gewesen. Aber nach Schwaan verirrte sich eben niemand von denen, die Weltmaßstäbe setzten. Das Drama der Provinz. Und so bekommt das Bild dieses halb ohnmächtigen, halb verwunderten Vis-á-Vis zweier auf ihre Geometrie reduzierten Kühe den Charakter einer modernen Apokryphe. Da vollzieht sich im Bild eine Wandlung von kopernikanischem Ausmaß – und nur zwei Kühe sind Zeuge dieser Destruktion des Naturalismus, des Schwunds des Ausgemalten. Was bleibt, ist ein Gerüst, um das sich Imagination – auch die des Betrachters – baut. Insofern ist Heinsohn sowohl stürmischer Expressionist als auch skeptischer Dekonstruierer der eigenen Überfülle. Übervolle Farb-Ekstase kontrastiert eine leere sprachlose Fläche. Der schroffe Widerspruch erzeugt hier einen Sog, der das Bild mitsamt Bildbetrachter in unaussprechbare Tiefen zieht.
Heinsohn kehrte nach dem ersten Weltkrieg in die Kaufmannsstadt Hamburg zurück, wo seine Bilder weiterhin unbeachtet blieben; 1927 nahm er sich das Leben. Auch der zweite Schwaaner Avantgardist hielt dem Druck der Umstände auf Dauer nicht stand: Rudolf Bartels erkrankte an Schizophrenie, und das machte es der provinziellen Umgebung leicht, ihn und seine Kunst nicht ernst zu nehmen. Ab einem gewissen Zeitpunkt lehnte er es ab, seine Bilder überhaupt noch zu rahmen: Kauft sowieso niemand! Nein, das stimmte zum Glück nicht ganz, sonst gäbe es heute den umfangreichen Bestand von Bildern der Schwaaner Künstlerkolonie nicht. So stand der Rostocker Hinstorff Verleger Peter E. Erichson nicht nur Barlach nahe, auch Rudolf Bartels. Und der Barlach-Freund Friedrich Schult organisierte 1926 in Güstrow die einzige erfolgreiche Ausstellung von Bildern Rudolf Bartels. Auch Ehm Welk besaß eines jener großformartigen Laternenbilder, die Bartels ab 1905 in Folge malte. Noch bis zum 1. Februar zeigt die Kunstmühle acht dieser Bilder in einer Sonderausstellung. Der Welk-Biograf Konrad Reich gestand einst dem Schriftsteller, unter solch Laternen-Bild würde er gern alt werden. Bartels ist kein Ekstatiker mit skeptischen Kälteschüben wie Heinsohn, er geht den Weg vom Impressionisten hin zum Alchimisten der Farbe – und diese, das spürt jeder vor seinen Bilder sofort – ist immer auch Chiffre für Seelenzustände. Mehr noch: ein kosmologischer Weltschlüssel in Alltagsszenen verborgen! Die farbsymphonischen Anklänge in seinen Landschaftsbildern werden immer drängender. Das innere Bild scheint sich dabei immer mehr mit dem äußeren zu verschmelzen. Zu besichtigen sind hier eindrucksvolle Wegzeugnisse einer ländlichen Wanderung hin zur reinen Malerei, die in eine Wandlung von kunstgeschichtlichem Ausmaß mündet.
Die »Laternenkinder« entziehen sich bereits jeder Reproduktion, wie dann erst einer Zeitungsabbildung in Schwarz-Weiß! Man bleibt auf die Originale in der wunderbaren, liebevoll von der Stadt Schwaan zum Kunstmuseum »ihrer« Maler umgebauten Kunstmühle verwiesen. Dort versteht man, was Bartels so fasziniert hat, dass er die Kinder mit ihren Lampions immer und immer wieder gemalt hat: Helle Lichtkreise in einer dunkel-bläulichen Nachtszenerie, in denen die Menschen und Häuser sich nur schemenhaft aus dem Hintergrund hervorheben. Minimalismus der Kontraste, Ton in Ton trotz grellstem Kontrast des Gelb-Orange der Laternen zum Blau-Grün der Nacht. Das Licht, hier wird es metaphysisch aufgefasst als die Quelle, die das Dunkel durchdringt. Erleuchtung und ihre Abbildbarkeit, natürliche und künstliche Lichtquellen mitsamt ihren folgenreichen Unterschiede, all das sind Themen, die Maler wie Rembrandt oder Vincent van Gogh immer wieder vorrangig interessierten und an denen sie sich abarbeiteten. Auch darum, weil sie dabei etwas über sich und das Warum ihres eigenen Mühens zu erkennen hofften: Bilder sind eben nie nur Abbilder, sondern auch Sinnbilder des Lebens. Und auch Rudolf Bartels Malen kreist um das, was auf der Leinwand zu leuchten vermag. Erstaunlich ist, dass die Stadt Rostock nicht nur bereits im Herbst 1945 eine umfangreiche Barlach-Ausstellung initiierte, sondern auch 1946 eine zu Rudolf Bartels. Dieser war 1943 in größter Armut in Rostock gestorben, das Altersheim hatte dem psychisch Auffälligen eine Aufnahme verweigert. Bizarrerweise setzt sich das Familiendrama fort – nun unter umgekehrtem Vorzeichen: 1954 schreibt sein ebenfalls der Schwaaner Künstlerkolonie angehöriger Bruder Otto an einen Verwandten: »Nachdem meine Geschwister alle verstorben waren und ich allein in der Wohnung war, beschlagnahmte das Wohnungsamt meine Wohnung und so blieb mir nur das Altersheim übrig.« Die Geschichte der sozialen Erniedrigung von Künstlern ist noch ungeschrieben. Otto Bartels starb 1958 in Rostock.
Lisa Jürß, früher Direktorin des Staatlichen Museums Schwerin – und gebürtige Schwaanerin – wirbt für »ihre« Schwaaner Künstlerkolonie wo sie nur kann, veröffentlichte erstmals auch Bildbände mit Bunke, Bartels, Heinroth und den anderen. Angesichts von Worpswede, das jeder kennt, bleibt jedoch ein eklatantes Missverhältnis. Schwaan ist also immer noch zu entdecken.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.