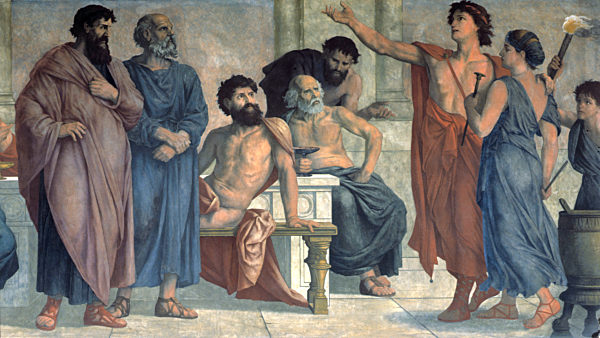Die Verfluchung
Volker Löschs »Marat« beendete Berlins Theatertreffen
Vielleicht ist Theater dann am besten! Wenn Gefangennahme so stark wird, dass danach bohrend ein Gespräch sein muss, nur keines über Theater. Aber eines, zum Beispiel, über den Zorn. So wirkt das Lösch-Theater.
Der Zorn geistert wie eine vergessene Sehnsucht durch die Zeit. Das Lösch-Theater ruft diese Sehnsucht zurück. Der Zorn ist der verlassene, verstoßene Partner jener Träume, die an den Schlaf der Welt zu rühren gedachten – er, der aufräumen sollte, trägt den Schmutz der Geschichte im Leumund. Er wurde das sperrige Erinnerungsstück in den revolutionären Gesinnungen, die belehrt zur Ruhe kamen. Dagegen trampelt das Lösch-Theater. Wo der Zorn noch auftritt, tritt er als Des-perado auf, als Sprengmeister einer verfluchten Zunft, die Flugzeuge in Häuser lenkt und Bomben zündet. Er ist der Held der letzten Vorstellungen, er verrät die Hoffnung fortlaufend an einen Gegner, der Kompromisse ausbrütet. Der Zorn, dessen Tugend der Einsturz ist, dessen Kraft einst Widerspruchsfelder in der Freiheit neuer Verhältnisse aufzupflügen vermochte, er schleicht als gezähmtes Tier durch unsere geheimen Wünsche vom reinen Tisch, der mit den Bedrängern zu machen sei. Das missbilligt das Lösch-Theater. Tätiger Zorn hat die Welt nie besser gemacht, aber er hat ihr die Lüge verweigert, als gut dazustehen. Sagt hoffend das Lösch-Theater. Aus Revolutionären, die den Zorn zu Beruf und Biografie erklärten, sind Trend-Designer geworden – in einer verdunstenden Geschichte, die nichts mehr weiß von der bezaubernden Kraft des Jakobinertums. Schreit klagend das Lösch-Theater.
»Jetzt schämen wir uns, mit größeren Hoffnungen schwanger gewesen zu sein.« Schreibt Peter Sloterdijk, und Regisseur Volker Lösch hat am Deutschen Schauspielhaus Hamburg den »Marat« von Peter Weiss so inszeniert, dass er zur Frage wird: »Was ist aus unserer Revolution geworden?« Vorwurf, Aufruf, Mahnschrei, Zornzufuhr. Freilich: ein Spiel in der Gummizelle.
Achims Buschs Marat: ein Kostümfest der Austauschbarkeiten, Lenin-Statue, dann ganz Fidel (Castro), aber am Stock, schließlich Lafontaine in der Badewanne, um erstochen zu werden. Figuren einer Abwärtsbewegung – die Empörung springt heute nicht mehr aus brennenden Augen, sondern wirft nur noch wässrige Blicke aus ein paar übrig gebliebenen Theorien – deren Populisten sich wie müde Revolutionsberater älteren Stils durch die geistige Obdachlosigkeit schlagen. Marion Breckwoldts de Sade steigert das Elend der satten Gesellschaft in den puren Ekel: Fettabsaugung zwecks anschließender Wiederverwendung als neue Schlürfmasse. Der selbstparasitäre Kreislauf der kapitalistischen Verwertung, der die Schraube von Brechts »Mahagonny« ein Stück weiterdreht: »Alles ist nur halb, ich äße mich gern selber«, wird dort gesungen.
Der Hartz-IV-Chor, der die Liste der reichsten Familien Hamburgs verliest wie lauter Todesurteile: Aus »Vaterunser ..., führe uns nicht in Versuchung«, wurde: Volkerunser, führe uns zur Verfluchung! Theater der Anklage, das im bürgerlichen Kunsttempel die Masken auffährt, um sie rabiat, rüde, aufrührerisch in zwei Stunden Unwirklichkeit fallen zu lassen. Die Welt ist wieder einfach: Oben und Unten. Man wehrt sich gegen diese Wahrheit. Sie ist zu einfach. Sie erfordert zu viel Mut. Sie entsteht nicht durch Denken, sie kommt durch Zorn. Wächst er?
ALFRED-KERR-PREIS
Den Alfred-Kerr-Preis des Theatertreffens erhielt Kathleen Morgeneyer für ihre Nina in Jürgen Goschs »Möwe« (Foto: Lieberenz). ND schrieb zur Premiere, Dezember 2008: »Hauptrolle für eine Unbekannte. Kennt jemand noch die russische Tschurikowa? Morgeneyer ist noch jünger, noch schmaler und eckiger, ein rührendes, wunderbar wehes und wehendes, dann wieder hemmungstolles Wesen, das sich an den engen Klamotten zupft, ein Menschlein von flammender Erwartungsröte, das vom Leben früh, aber auf Dauer gemürbt und gewürgt wird. Ihr zuzuschauen heißt: Seele spüren ohne Ende. Also unendlich traurig.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.