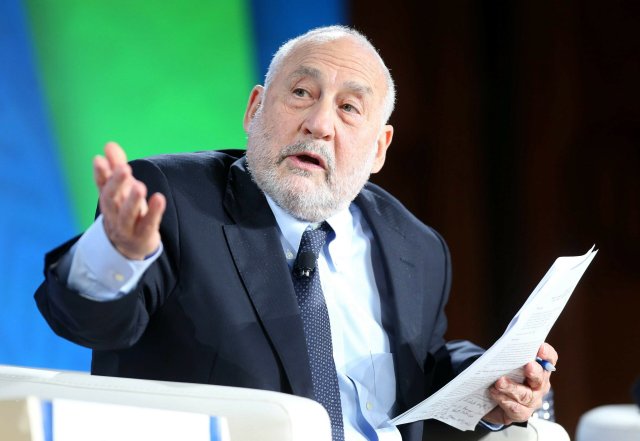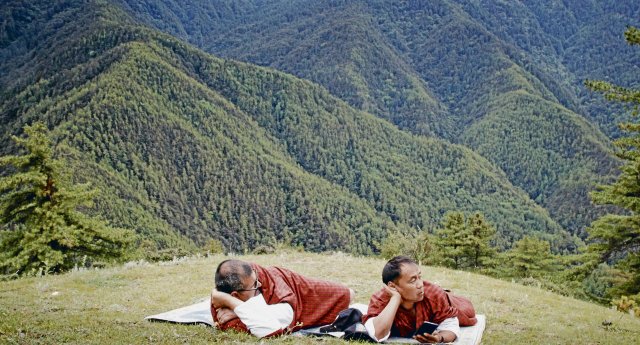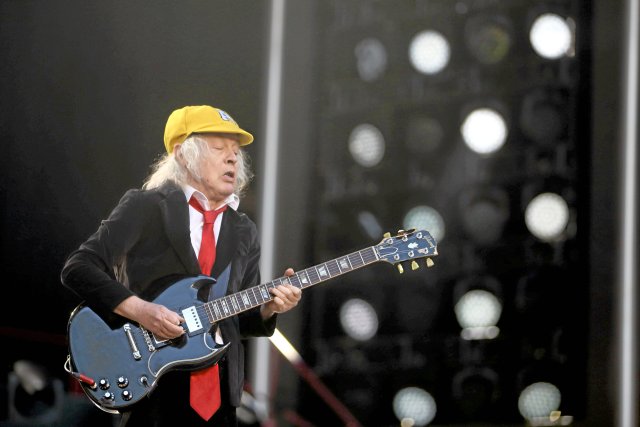Warum hast du uns verlassen?
Friedrich Schorlemmer zur Diskussion um den »Hessischen Kulturpreis«
Ich gestehe: Ich verstehe nichts mehr. Ich verstehe meine beiden christlichen Brüder Lehmann und Steinacker nicht, die meinen, es sich und den anderen Christen nicht zumuten zu können, mit Kermani zusammen diesen Preis »für religiöse Verständigung« in Empfang zu nehmen.
Ich finde, dass Kermanis in der NZZ abgedruckte Betrachtung des Bildes von Guido Reni, »Kreuzigung«, etwas Existenzielles auf- und anrührt, worüber miteinander ernsthaft zu sprechen ist – zumal sich im Christentum in Jahrhunderten eine Leidensmystik herausgebildet hat, die das Leiden religiös überhöht und dabei eine spirituelle Versenkung hervorgebracht hat, die über reales Leiden hinwegführt. Ich erinnere mich an den stummen Aufschrei im Holzschnitt von Schmidt-Rottluff: »1916 ist euch nicht Christus erschienen« – ein Reflex auf das Grauen von Verdun, wo Soldaten zweier christlicher Völker sich in ihren Schützengräben gegenüberlagen und
einander so barbarisch abmurksten, in Reichweite ihrer Feldprediger im »bewachten Kriegsschauplatz« (Tucholsky).
Kermani ist ein in Deutschland sozialisierter Muslime. Er gehört zu den muslimischen Intellektuellen, die den Koran nicht Wort für Wort getreu herbeten, sondern ihre eigene Glaubenstradition in einen kritischen Diskurs zu bringen bereit sind. Er tut genau das, was wir bei vielen Muslimen so sehr vermissen und immer wieder einfordern. Er macht sich ganz und gar nicht lustig, macht sich auch nicht über die religiösen Gefühle und Gedanken anderer her; er beschreibt seine eigenen Gefühle und Gedanken angesichts einer Leidenshypostasierung im Christentum, die den Gequälten auch noch anbetet (Hypostasie: Verdinglichung von Begriffen; Personifizierung göttlicher Eigenschaften oder religiöser Vorstellungen).
Kermani gehört genau zu denen, die der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer längst erlebt und erduldet hat, nämlich die feinen Philosophen, die einen gekreuzigten Gott als eine philosophische Torheit schelten und auch die Juden, die die Verleiblichung und Tötung des für sie unausprechlichen Gottes als einen Skandal, als Bilderanbetung und Götzendienst empfinden. Was das denn für ein Gott sei, der seines Sohnes Opfer braucht, um uns gnädig zu sein, dies bleibt doch eine (für jeden) bohrende Frage, durch die Jahrhunderte hin. Braucht der liebende Gott ein Opfer? Und gar noch das seines geliebten Sohnes?
Zugleich hat Kermani wohl nicht verstanden, verstehen wollen und können, dass die Betrachtung des Leidens Christi den Menschen trösten, ihn Solidarität empfinden lassen und in helfende Solidarität führen kann. Ein Christ lernt in der Betrachtung des Leidens »des Gottesknechtes«, besser mit eigenem Leiden fertig zu werden, er kann in seinem Leiden die Nähe Christi erfahren und jedes Leiden im Geiste Jesu vermindern und bekämpfen.
Kermani steht nun vor dem Altarbild Guido Renis und findet den Anblick so berückend, »so voller Segen, dass ich am liebsten nicht mehr aufgestanden wäre. Erstmals dachte ich: Ich – nicht nur: man –, ich könnte an ein Kreuz glauben.« Er entdeckt im Gekreuzigten etwas, das wir allzu selten entdecken: dass nämlich dieser Gekreuzigte über uns seine Arme ausbreitet, segnend, nicht Fäuste ballend, Aber er endet mit einem Schrei, den man hinterher nicht wegdeuten und abmindern kann. Warum? Warum hast du, Gott, mich verlassen? Und Kermani sieht im Bild Renis einen Imperativ; Jesus scheint zu rufen: »Nicht nur: Schau auf mich, sondern: Schau auf die Erde, schau auf uns.« Ja, Jesus klagt und klagt an. Er klagt Gott an, dass er ihn verlassen habe – und dass er uns verlassen habe. Dies doppelte Du: Warum hast du, Gott, uns verlassen? Und warum habt ihr Mitmenschen ihn verlassen, die Leidenden übersehen? Das ist alles so anrührend, so ehrlich, so doppel- und dreibödig, so persönlich und so mutig. Kermani verwischt nichts. Er stellt Fragen, die nicht von außen kommen, sondern durch sein Innerstes hindurch gingen.
Ich sehe in seinen Einlassungen nicht zuerst dialektisch-literarische Kunstgriffe, sondern persönliche Ergriffenheit. Vor vierzig Jahren hat solche Fragen die Theo-Poetin Dorothee Sölle gestellt, verdichtet in Passionsgebeten eigener Art. »Er schwitzt blut/ darum sagt er/ wein nicht./ Er wird aufgegeben/ darum sagt er/ gib nicht auf./ Er wird verurteilt/ für seine sache: den himmel/ darum sagt er/ sieh hin die erde.«
Man mag die Ausführungen Kermanis ablehnen und seine sprachlichen Zuspitzungen – wie »christliche Ideologie« oder »Hypostasierung des Schmerzes« als etwas Barbarischem, Menschenfeindlichem – befremdlich und geradezu kränkend empfinden. Für Kermani ist die Ablehnung der Kreuzestheologie Ausdruck einer generellen Ablehnung von »Idolatrie«. Und dass er Kreuzen gegenüber »prinzipiell negativ eingestellt« ist, hängt gewiss mit vielem Missbrauch dieses Symbols zusammen. Kermani hat beschrieben, was er in einem bestimmten Kreuzigungsbild gesehen hat, wie er das Leiden Jesu bewertet, warum er dieses Gottesbild nicht teilt und teilen kann. Er sieht im Gekreuzigten plötzlich die ganze Verzweiflung der geschundenen Kreatur, im Moment des Verendens, und kann keinen Gedanken an die Wiederauferstehung hegen.
Wenn nun meine beiden hohen geistlichen Brüder den Kulturpreis nicht gemeinsam mit Kermani annehmen zu können meinen, dann verraten sie für mich nichts mehr als ihre innere Unsicherheit über ihre eigene Position.
Dialog braucht Toleranz, Respekt vor dem Anderen, aber auch ehrliches Aussprechen, welche Position man nicht teilen kann. Der Dialog hält kontroverse Positionen aus, verwischt keine Grenzen, bloß um des lieben Friedens willen. Eine Beleidigung oder eine Missachtung kann ich bei Kermani nicht erkennen, wohl aber eine Verdeutlichung der Differenz, in wohltuend persönlicher Sprache. Wahrheitsbesitzer reden immer objektiv, Wahrheitssucher subjektiv.
Vielleicht müssen alle noch mehr lernen, subjektiv zu reden, in existenzieller Ich-Sprache. Es wäre ein gutes Zeichen, wenn in dieser Lage alle Preisträger auf jenen Preis verzichteten und stattdessen den offenen Dialog miteinander begännen, fortführten. Solch Dialog bedarf keines Preises, hat wohl aber einen Preis. Für jeden Beteiligten.
Im Übrigen wurde Kermani gerade zum Mitglied der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung berufen. Ein schönes Zeichen für gelingende Integration; die von Christen erpresste Preisverweigerung bleibt eine Schmach. Vielleicht kommt es aber nun doch noch zum verpassten Gespräch? Dies würde das Anliegen des Preises »ohne Preis« erfüllen.
- Wenn Lehmann, Steinacker nicht gemeinsam mit Kermani geehrt werden wollen – verraten sie nicht ihre eigene Unsicherheit?
- Ist das nicht die Frage, die durch Jahrhunderte geht? Warum braucht ein liebender Gott ein Opfer?
- Was kann es Menschen lehren, den leidenden »Gottesknecht« Jesus Christus am Kreuz zu betrachten?
- Die von Christen erpresste Preisverweigerung bleibt eine Schmach – aber braucht weiterer Dialog einen Preis?
Der Theologe Friedrich Schorlemmer (Jg. 1944) ist Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels (1993).
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.