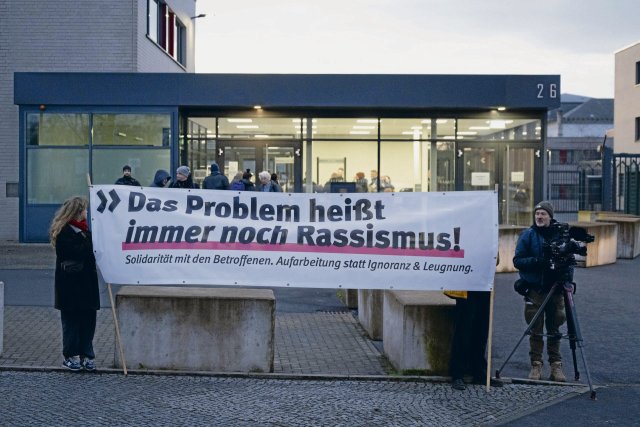»Innerpolnischer Krieg« dauert an
Präsidentschaftskandidaten fordern zur »Einheit« auf, aber kein Pardon für die »Kommune«
Auch von der Notwendigkeit, »den polnisch-polnischen Krieg zu beenden«, ist in der laufenden Kampagne zur Staatspräsidentenwahl zu hören. Der Kandidat der »Bürgerplattform«, Sejmmarschall Bronislaw Komorowski, kündigte die Parole »Eintracht baut auf« an, sein Kontrahent, der Parteichef von »Recht und Gerechtigkeit« und ehemalige Ministerpräsident, Jaroslaw Kaczynski, ruft aus: »Machen wir doch endlich Schluss mit dem polnisch-polnischen Krieg!«
Egal, wie man diese patriotischen Appelle bewerten mag – fest steht, dass diese von beiden Seiten unehrliche Umarmungsstrategie im zerstrittenen »Post-Solidarnosc-Lager« Grenzen hat. Das linke Wochenblatt »NIE« fragte, um welchen »polnisch-polnischen Krieg« es sich handele. In jenem, der seit 21 Jahren nicht aufhören will, gebe es weiterhin kein Pardon. Der Nachlass und die Traditionen der Volksrepublik Polen würden so traktiert, als ob es Polen ein halbes Jahrhundert nicht gegeben habe. Der »zweiten Republik« 1918-1939 wurde 1989/90 gleich die »dritte« angeschlossen. Die moralische Verteufelung ist gepaart mit gesetzlicher Diskriminierung jener Menschen, die sich in der alten Gesellschaftsordnung aktiv engagiert hatten – schreibt »NIE«. Das Blatt zitiert den weit von der Linken entfernten Soziologen Andrzej Walicki: »Polen zeigt sich als Land eines kriegerischen Pseudo-Antikommunismus, der alles aus der VRP verschmäht und verdammt, eines Antikommunismus ohne Kommunisten, der nicht gegen nicht existierende Kommunisten, sondern gegen Menschen mit einem Werdegang in der damaligen Zeit gerichtet ist.«.
Manches von diesem Pseudo-Antikommunismus ist noch recht milde. »Gazeta Wyborcza« schuf den Spruch »Die da dürfen weniger«, vermerkt »NIE«. Aber wie tief sich das Post-Solidarnosc-Lager auch zerstritt, in der Diskriminierungs- und Geschichtspolitik waren sich seine »Abzweigungen« immer einig. Die Wahlaktion Solidarnosc und die »Freiheitsunion« riefen gemeinsam das »Institut des Nationalen Gedächtnisses« ins Leben, und »Bürgerplattform« wie »Recht und Gerechtigkeit« beschlossen ebenfalls zusammen Diskriminierungsgesetze.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.