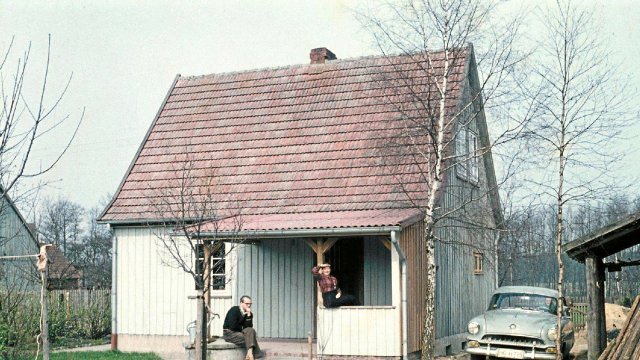Die Freier und Geier der Anna Seghers
Von Christel Berger
... Jetzt sind Sie tot, Anna Seghers
was immer das heißen mag
Ihr Platz; wo Penelope schläft
Im Arm unabweislicher Freier
Aber die toten Mädchen hängen an der Leine auf Ithake
Von Himmel geschwärzt, in den
Augen die Schnäbel
Während Odysseus die Brandung
pflügt
Am Bug von Atlantis.
Heiner Müller, 1990
..........................................................
Als die Teilnehmer des IX. Schriftstellerkongresses der DDR am 1. Juni 1983 erfuhren, dass Anna Seghers, ihre Ehrenpräsidentin und frühere Präsidentin über mehr als ein Vierteljahrhundert lang, gerade gestorben sei, zog für kurze Zeit tödliche Stille in den Saal. Jetzt waren sie wirklich allein ... Viele, die hier saßen, hatten sie persönlich gekannt, hatten von ihr Hilfe und Zuspruch erfahren. Alle wussten, dass der Glanz der Literatur dieser großen Schriftstellerin und ihre Autorität es erleichtert, ja erst ermöglicht hatten, dass Autoren des Verbandes im In- und Ausland Freunde gefunden hatten. »Man war wer« - auch durch sie. Und so wurde aus Stille und Betroffenheit in kurzer Zeit lüsterne Betriebsamkeit. Die Akademie der Künste, deren Gründungsmitglied sie gewesen war, hatte laut Protokoll die große Trauerfeier zu organisieren. Ich gehörte zu den Mitarbeitern dieser Institution, wir gaben uns wirklich alle Mühe um diese besondere Tote. So gelang es uns mit List und Sensibilität, durchzusetzen, dass am Schluss des Staatsakts ihre Stimme nicht mit irgendeinem ideologisch/theoretischen Satz aus einem ihrer Referate übertragen wurde, sondern mit dem Schlusssatz aus dem »Ausflug der toten Mädchen«. Wir waren auch froh, dass - wie schon bei anderen Staatsbegräbnissen der Akademie - das militärische Zeremoniell gemildert worden war, indem man auf Böllerschüsse am Grab verzichtete. Aber sonst? Behelmte Paradesoldaten mussten sein. Die Staatsführung und die offizielle Trauergemeinde musste auf dem Friedhof abgegrenzt werden von den einfach so erschienenen trauernden Lesern und auch von dem unverhofft aufgetauchten alten Verleger Fritz Landshoff. »Staatstrauer« hieß es, nicht »Volkstrauer« (war denn auf die Millionen von Lesern Verlass?), und das bedeutete: steif und militant. Schmückten noch schlichte, wahre Sätze von Anna Seghers über Frieden, Hoffnung und die Macht der Literatur die Bühne des »Konrad-Wolf-Saals«, so »klirrte« es gewaltig beim Hauptredner Kurt Hager. »Ihr Wort gehört für immer in unser Waffenverzeichnis« - hieß die Überschrift seiner Rede. Hatte er nichts von der Einfachheit und Nüchternheit der Literatur dieser Frau begriffen?
Aber auch: Hatte ich ihre letzten, 1980 erschienenen, Erzählungen »Drei Frauen von Haiti« wirklich verstanden? Anna Seghers erzählte Frauenschicksale, und ich las darin vor allem ihr Festhalten an Revolution und dem Traum der Menschheitsbefreiung. Die Resignation, die auch in den Geschichten war, hatte ich sie überlesen oder hatte ich es als Marotte, als das Murmeln einer Alten abgetan?
Die Jahre gingen ins Land. Der 85. Geburtstag 1985 - die üblichen Lobreden. Sie war ein Denkmal geworden. Dann brodelte und stürmte es im Land, und ausgerechnet einer der alten Weggefährten bewirkte den Sturz vom Sockel. Walter Janka beschuldigte sie unterlassener Hilfeleistung. Als er 1956 verhaftet und wegen konterrevolutionärer Verschwörung angeklagt wurde, habe Anna Seghers wider besseres Wissen zu den falschen Vorwürfen geschwiegen. Janka beschuldigte noch andere: Johannes R. Becher, Helene Weigel, aber keinen traf es so wie Anna Seghers. Schulen legten ihren Namen ab. Bibliotheken musterten ihre Bücher aus. Es war, als hätte man einen lange gesuchten Grund gefunden, sich zu befreien, zu lösen. Denn ihre Literatur hatte einen Sog und einen Reiz - Vernunft und Mythos ließen einen nicht los. Und sie als Person und Funktionärin - eine schöne alte Frau, mütterlich, geheimnisvoll, die nie politisch überzogen hatte, immer bemüht, den Schwachen zu stärken. Dass diese Frau und Künstlerin gefehlt haben sollte, hat manche aus ihrem Bann erlöst, für immer, und andere sehend gemacht.
Bezeichnenderweise stammt Heiner Müllers »Epitaph« aus dem Jahre 1990, wurde sieben Jahre nach ihrem Tod geschrieben. Nun, so schien es, war sie wirklich tot. Heiner Müller platzierte sie »wo Penelope schläft« - bei den unsterblichen Mythen und Großen der Literatur. Die »unabweislichen Freier« freilich hat es doch schon vorher gegeben: Gehörte Kurt Hager mit seiner Rede nicht dazu und reihte sich Walter Janka nicht gerade bei ihnen ein? Die Schriftstellerin selbst hat sich gegen die ungerechten Beschuldigungen so wenig wehren können wie gegen die falschen Lobeshymnen. Kamen nun die Geier oder andere Raubvögel, deren Schnäbel den toten Mädchen die Augen aushackten? Gerade den »toten Mädchen« - diese Erzählung gehört zum goldenen Bestand der Literatur des 20. Jahrhunderts, modern wie kaum ein Text aus der Entstehungszeit, aber eben nicht nur verständlich für Literaturfeinschmecker.
Doch wissen wir nicht von Hölderlin - »Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.« Selbst die »unabweislichen Freier« oder gar die Geier haben ungewollt etwas vom Rettenden transportiert: Eine Gefallene ist interessanter als eine Versteinerte. So erwachten und wuchsen »Rettungsgeister«: Freunde, Kenner, Interessierte. Seitdem gibt es neue Debatten um Anna Seghers, neue Forschungen, zum ersten Mal auch differenzierte biografische Darstellungen. Seitdem - und sie ist nun schon über ein Jahrzehnt gewachsen - gibt es eine »Anna-Seghers-Gesellschaft. Berlin/Mainz e. V.«, deren Mitglieder nicht nur »West-« oder »Ostdeutsche« sind. Was hätten wir beispielsweise ohne »unsere« amerikanischen Germanisten gemacht, die souverän kleinkarierte Schuldüberlegungen mit Verweisen auf weltliterarische Bedeutung und auf neue Forschungsarbeiten vom Tisch schoben? Jedes Jahr erscheint ein neues Seghers-Jahrbuch »Argonautenschiff«.
Wenn auch Anna Seghers wollte, dass man sie allein durch ihr Werk kennt, und sie manches dafür tat, ihr Leben nicht öffentlich zu machen, sie verrätselte es geradezu manchmal - wir wissen heute dank intensiver Forschung und wichtiger Publikationen (dem Aufbau-Verlag sei Dank!) mehr von ihr. Das beispielsweise rückte sie wieder in das Interesse ihrer Leser. Anna Seghers, die immer so adrett und diszipliniert, aber nie pathetisch und übertrieben große Tagungen und Treffen eröffnet hatte, von der kein Skandal, höchstens mal eine fürwitzige Anekdote bekannt geworden war, war mit ihren Figuren, die es allesamt schwer gehabt haben, »im Bunde« gewesen. Sie hatte Einsamkeit und Verlassensein gekannt, - Zweifel, Niederlagen, nicht zu bewältigende Trauer. Den Tod der Mutter 1942 während der Deportation nach Piaski bei Lublin hat sie nie öffentlich erwähnt. Wie sehr hatte sie mit »ihrem armen Volk« gelitten? (So hat sie die Juden einmal in einem unbeherrschten Augenblick im Beisein Stephan Hermlins genannt.) Erst jetzt wird die Meistererzählung »Post ins gelobte Land« unter diesem Aspekt »neu« gelesen, der Aufsatz »Passagiere der Luftbrücke« von 1948 wiederentdeckt!
Dass Laszlo Radvanyi und der Ökonomieprofessor Johann-Lorenz Schmidt ein und dieselbe Person und ihr Ehemann für ein ganzes Leben war, wussten nur wenige. Wie schwer sie daran getragen hat, dass er Jahre brauchte, ehe er aus Mexiko zurückkehrte, erfuhr man erst aus den Briefen, die erstmalig 2000 veröffentlicht wurden. Dass sie nicht die einzige Frau in seinem Leben war, blieb ihrer beiden Privatproblem. Die Biografen gehen zwar zurückhaltend mit diesem Fakt um, dennoch ist er nun in der Öffentlichkeit. Manchmal müssen Germanisten zu »Geiern« werden - Berufspflicht. Wie oft und wie schwer sie seit den 50er Jahren krank war, ahnte ihre Lesergemeinde nicht, erschien doch regelmäßig Neues von ihr. Beim Schreiben war sie »bei sich«, so vertrieb sie manchmal die Schatten der Krankheit und des Alters, die mehr und mehr von ihr Besitz ergriffen. Nicht alle Beschlüsse und offiziellen Äußerungen, die ihre Unterschrift tragen, hat sie im Vollbesitz ihrer Kräfte und Sinne unterschrieben.
Nun also ist sie laut Heiner Müller auf »Ithaka«, der umstrittenen Heimatinsel von Odysseus, wo die treue Gattin Penelope seiner harrt. »Ithaka« bedeutet auch: Warten, treu sein, die Freier abweisen. Heiner Müllers Bild stimmt. Lebenslang war sie der Entscheidung ihres Lebens treu, sie wollte arbeiten und vor allem schreiben für eine bessere, gerechtere Welt. Die verband sie mit dem Kommunismus. Als sich zeigte, dass auch ihre Genossen zum Machterhalt ungerecht und brutal waren, hat sie das gequält.
Als 1990 in der Aufbau-Reihe »Texte zur Zeit« die Novelle »Der gerechte Richter« erschien, war das auch Teil dieses Anfangs, eine »neue« Anna Seghers zu entdecken. Anna Seghers hatte es nicht gewollt, dass dieser Text über einen Genossen, den die Seinen schuldlos inhaftieren, veröffentlicht wird. Nicht nur aus Angst wegen des Tabubruches. Sie hat wohl auch gespürt, dass sie den Text nicht gemeistert hat. Dass Leute, die für Gerechtigkeit und gegen Unterdrückung ihr Leben eingesetzt hatten, selber ungerecht werden können, wusste sie aus den Legenden. Dass das jedoch auch die Eigenen und das eigene Leben betrifft, ist eine Erfahrung, die Leben und Werk zerstören kann. Anna Seghers wollte sich nicht zerstören lassen und wollte »treu« bleiben. Ein Spagat, der ihr Leben härter machte als wir ahnten, und in ihrem Werk Texte hinterließ, die die letzte Meisterschaft vermissen lassen.
Damals 1990 wurde der Text nur im Bezug auf Walter Janka gedeutet. Wir wissen heute, dass Anna Seghers diese Problematik schon vor 1957 beschäftigte, dass viele ihrer Freunde und nahen Bekannten falschen Verdächtigungen ausgesetzt waren, die sie entweder mit dem Leben oder wichtigen Lebensjahren bezahlen mussten: Noel Field, Lenka Reinerová, Otto Katz (André Simone), Georg Lukacz ... Anna Seghers hat, auch das wissen wir heute, wenn sie konnte, zu vermitteln versucht. Für Walter Janka hat sie mehr getan, als er es sich eingestand. Zu lange mit seiner berechtigten Verbitterung allein, konnte und wollte er am Ende auch nicht gerecht sein. Aber die Hoffnung auf eine bessere Welt hatten weder Walter Janka noch Anna Seghers aufgegeben.
Wie viele Zweifel sie dabei hatte, wie kritisch sie dabei auch »ihre« Leute sah, lese ich bezeichnenderweise nun viel deutlicher auch in den Werken, die zu ihren Lebzeiten publiziert wurden, selbst in den nicht unberechtigt der Staatsnähe beschuldigten Romanen »Die Entscheidung« und »Das Vertrauen«. Marcel Reich-Ranicki, der gerade von Ost nach West gewechselt war, meinte in der Rezension zur »Entscheidung«, nun sei die »geistige Kapitulation« der Anna Seghers perfekt. Kurz vorher hatte er in Polen ein Buch über Anna Seghers voller Lob und Bewunderung geschrieben. Anna Seghers hat sich damals um diesen »unabweislichen Freier« nicht geschert. Ihr Platz ist »Ithaka«, dort wartet sie. Auf Leser, die genau lesen? Auf eine Welt, die sozial gerecht, farbig und warm ist?
Im Aufbau-Verlag liegen bereits mehrere Bände einer neuen Anna-Seghers-Werkausgabe vor. Im Herbst erscheint eine bisher unveröffentlichte Erzählung.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.