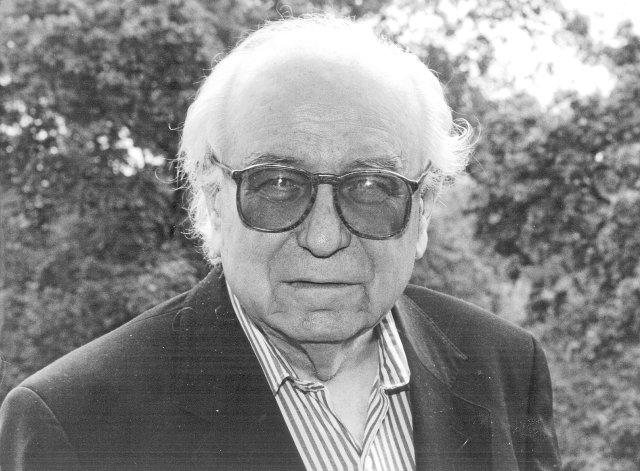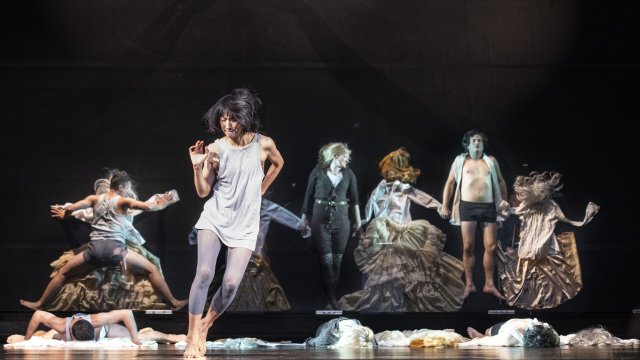- Kultur
- Latinos bei den Alliierten
Als die Kobra zu rauchen begann
Die einzigen Lateinamerikaner in den bewaffneten Streitkräften der Alliierten waren Brasilianer

Brasiliens Staatspräsident Getúlio Vargas hatte aus seinen Sympathien für Mussolini und den italienischen Faschismus nie einen Hehl gemacht: Als er im September 1937 mit einem Staatsstreich die Verfassung seines Landes außer Kraft setzte, um auf Lebenszeit im höchsten Staatsamt bleiben zu können, und im November 1937 damit begann, seinen Estado Novo, den Neuen Staat, zu schaffen, orientierte er sich in vielen Aspekten am italienischen Vorbild. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs allerdings bewahrte er zunächst eine abwartende Position und versuchte, sich gegenüber den weltweit kriegführenden Parteien neutral zu verhalten. Erst massiver politischer Druck und ökonomische Offerten seitens der USA bewirkten ab Sommer 1941 eine schrittweise Korrektur dieser Position.
Am 1. Oktober 1941 unterzeichneten US-amerikanische und brasilianische Regierungsvertreter ein Abkommen, das der USA-Kriegsmarine Nutzungsrechte für die Atlantikhäfen in den brasilianischen Bundesstaaten Bahia, Pernambuco und Rio Grande do Norte sowie auf der dem brasilianischen Festland vorgelagerten Insel Fernando de Noronha einräumte. Außerdem wurden im Nordosten Brasiliens mehrere Geschwader der US-amerikanischen Seefliegerkräfte stationiert. Im Gegenzug verpflichteten sich die USA zur Finanzierung und zum Aufbau eines metallurgischen Komplexes in Volta Redonda im Bundesstaat Rio de Janeiro, der bis zu seiner Stilllegung Anfang der 90er Jahre wesentliche Bedeutung für die brasilianische Stahlproduktion hatte.
Im Januar 1942 brach Brasilien die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland und dessen Verbündeten ab. Doch noch immer weigerte sich Staatspräsident Getúlio Vargas, einem stärkeren Engagement Brasiliens innerhalb der Anti-Hitler-Koalition zuzustimmen. In der brasilianischen Öffentlichkeit machte deshalb das Wort die Runde: »Eher wird eine Kobra rauchen, als dass brasilianische Truppen marschieren.«
Als unmittelbare Reaktion auf den Abbruch der diplomatischen Beziehungen versenkten deutsche U-Boote zwischen Januar und Juli 1942 insgesamt 13 brasilianische Frachtschiffe. Doch Staatspräsident Getúlio Vargas zögerte weiterhin. Erst nach dem Verlust von weiteren fünf Frachtschiffen im Südatlantik und dem Tod von mehr als 650 Seeleuten innerhalb von nur zwei Tagen erklärte Brasilien am 22. August 1942 Deutschland, Italien und deren Verbündeten schließlich offiziell den Krieg. Brasilien begann nun mit aktiven militärischen Handlungen, so mit der Teilnahme an der alliierten U-Boot-Abwehr im Südatlantik. Die Entscheidung über einen Einsatz brasilianischer Truppen auf dem europäischen Kriegsschauplatz fiel im November 1943.
Am 2. Juli 1944 landeten die ersten Einheiten der Força Expedicionária Brasileira (FEB), der Brasilianischen Expeditionsstreitkräfte, wie die offizielle Bezeichnung lautete, im italienischen Neapel, das seit Oktober 1943 von US-amerikanischen Truppen besetzt war. Nun endlich marschierten brasilianische Truppen, rauchte die Kobra, und die brasilianischen Soldaten machten das mit einem Emblem deutlich, das sie auf dem linken Oberarm ihrer Uniformen trugen: eine Schlange, die eine Pfeife raucht.
25 334 Offiziere und Mannschaften der brasilianischen Land- und Luftstreitkräfte unter dem Kommando des späteren Marschalls João Baptista Mascarenhas de Morais kämpften bis zur Kapitulation Hitlerdeutschlands am 8. Mai 1945 im Bestand der 5. US-Armee in Italien. Die Soldaten der FEB erlebten ihre Feuertaufe am 14. September 1944 im Tal des Flusses Serchio, nördlich der Stadt Lucca in der Toscana. Ihren ersten großen Sieg konnten sie feiern, als sie wenige Tage später die Stadt Massarosa mit knapp 20 000 Einwohnern befreiten. In den folgenden Wochen und Monaten waren brasilianische Truppen an den Operationen in der Po-Ebene (September und Oktober 1944), der Eroberung von Monte Castello (November 1944 bis Februar 1945) und Montese (April 1945) sowie an der Schlacht von Collechio (April 1945) beteiligt. Am 28. April 1945 ergab sich die 148. deutsche Infanteriedivision den Truppen der FEB. Zwei Generäle, fast 900 Offiziere und knapp 20 000 Soldaten gingen in brasilianische Kriegsgefangenschaft.
Zur Força Expedicionária Brasileira gehörten nicht nur Männer, die in späteren Jahren als hochrangige Militärs eine wichtige Rolle in der Geschichte ihres Landes spielen sollten, wie Humberto de Alencar Castello Branco, der in den Jahren der Militärdiktatur zwischen 1964 und 1967 Staatspräsident war, oder Albuquerque Lima, von 1967 bis 1969 Innenminister. Zu den brasilianischen Soldaten auf dem europäischen Kriegsschauplatz gehörten auch Celso Furtado, der später als einer der bedeutendsten lateinamerikanischen Wirtschaftswissenschaftler und Intellektuellen galt, und Salomão Malina, der zwischen 1987 und 1991 Vorsitzender der Brasilianischen Kommunistischen Partei war.
Mehr als 450 Brasilianer verloren in den Kämpfen für die Befreiung Italiens ihr Leben. Ihre sterblichen Überreste wurden, nachdem sie zunächst auf dem Friedhof der italienischen Stadt Pistoia bestattet worden waren, 1960 nach Brasilien überführt und in Rio de Janeiro beigesetzt, wo aus diesem Anlass im Stadtteil Flamengo ein nicht nur architektonisch bemerkenswertes Denkmal für die Toten des Zweiten Weltkriegs errichtet wurde.
Dr. Ronald Friedmann ist Mitglied des Sprecherrates der Historischen Kommission der Linkspartei, die zum 80. Jahrestag der Befreiung eine Erklärung verabschiedet hat: Eine historische Chance: Die Linke Historische Kommission
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.