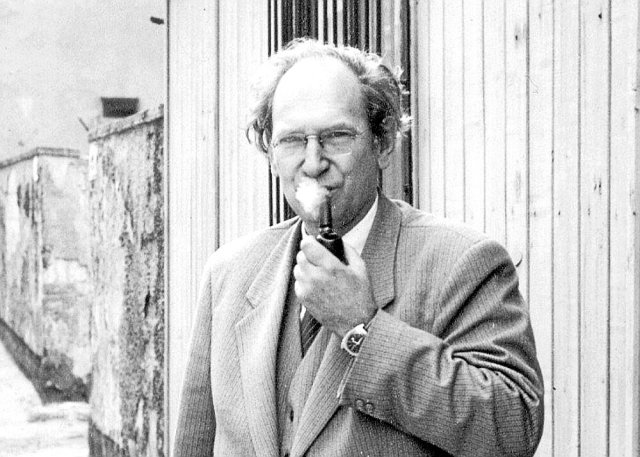Vielleicht sind wir einfach zu feige
Wie 30-Jährige mit Arbeitslosigkeit und der Angst vor der Zukunft umgehen
Es sollte eine ernste, eine bedrückende Sendung sein. Der in allen Medien herumgeisternden »Krise«, die nun auch die erfolgreichen, hoch qualifizierten Gewinner der Börsenboom- und New-Economy-Jahre erreicht hatte, wollte diese Reportage Gesichter geben. Eines davon gehörte Katja Leßmeister, die seit ihrem 28. Lebensjahr als Werbeleiterin eines Telekommunikationsunternehmens tätig gewesen war. Wöchentliche Arbeitszeit 60 bis 70 Stunden, Jahreseinkommen »weit über 100000 Euro«, Arbeitsplatz global, Hauptwohnsitz eine Villa in Bad Homburg, keine Zeit, kaum Freunde, dafür zwei ununterbrochen klingelnde Handys. Entlassen im Mai 2002.
Aufgetakelt auf dem Arbeitsamt
Zum Zeitpunkt des Drehs klingelte bei Katja kein Handy mehr, stattdessen rief sie ihren Vater an und erzählte ihm, dass sie den ganzen Vormittag über Bewerbungen geschrieben hatte. Man sah sie aufgetakelt und verschämt auf dem Münchner Arbeitsamt herumsitzen, wo ihre ratlose Beraterin der einstigen Top-Verdienerin empfahl, sich doch mal um ein unbezahltes Praktikum zu bemühen. Man erfuhr, dass sie mit dem Arbeitsplatz auch ihren Lebensgefährten verloren hatte und statt in der Villa nun in einem Keller-Apartment leben musste.
»Keller-Apartment«. Ich musste unfreiwillig grinsen. In einer anderen Szene sah man Katja zum Einkauf in einen Billig-Discounter fahren - mit ihrem schicken, teuren Sportwagen. Wenig später erzählte sie, die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben, dass es höchstens noch zwei, drei Monate weiterginge. Dann sei der Rest ihrer Abfindung aufgebraucht.
Nach allem, was sie in dieser Sendung von sich preisgegeben hat, verkörperte Katja Leßmeister vor ihrer Arbeitslosigkeit - ein Wort, dass sie »früher nicht einmal in den Mund genommen hätte« - genau jenen Vertreter der unbeschwerten Spaßgesellschaft, der seit Florian Illies' Bestseller »Generation Golf« zum Prototyp meiner Generation gemacht werden sollte: weltgewandt und stilsicher, ich-bezogen und unpolitisch, unternehmerisch und erlebnisorientiert. Glaubt man den Selbstdarstellungen in Büchern, Filmen und Feuilletons, lief für diese Leute alles immer wie von alleine. Leicht gelangweilt schwafelten sie über ihre neuesten Wertpapiere, über Movies, Musik und Mode, wussten über jeden neuen Trend bestens Bescheid und ließen sich auf den Wellen des Wohlstands treiben. Das ganze Leben schien so leicht wie eine ewig andauernde behütete Kindheit.
Doch kaum war das neue Jahrtausend angebrochen, bröckelte plötzlich der Putz von den Wänden der Luftschlösser, in denen man es sich bequem gemacht hatte. Das World Trade Center in New York, wohin man mindestens zwei Mal jährlich flog, stürzte zusammen, während zu Hause das eigene Start-up-Unternehmen auf den Konkurs zusteuerte. Die Zeitung, für die man seit seinem 20. Lebensjahr gut bezahlte Lifestyle-Glossen geschrieben oder bei der man sogar einen Redakteursstuhl erklommen hatte, wollte nichts mehr von einem wissen, die Aktienkurse fielen ins Bodenlose und die Sushi-Häppchen auf den Empfängen, bei denen man seine neuesten Armani-Anzüge zur Schau getragen hatte, wurden durch Salzstangen ersetzt.
Und während Katja Leßmeister sich in ihr Keller-Apartment verkroch, um auf ihrem Laptop Bewerbungen zu schreiben, die zumindest bis zum Zeitpunkt der Sendung allesamt erfolglos blieben, begannen immer mehr der protestlosen Protagonisten dieser den Kapitalismus bejahenden Generation, sich selbst in Frage zu stellen. Florian Illies etwa hat seine Stelle bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufgegeben und »Generation Golf zwei« geschrieben. Seine Figuren sitzen nun immer seltener in schicken Cafés, um bei angesagten Getränken die eigene Kindheit zu glorifizieren und die 68er Elterngeneration mit Spott zu überziehen. Stattdessen suchen sie - verängstigt vom ersten Erleben des Scheiterns - Sicherheit und Geborgenheit. Sie ziehen die Vorhänge zu, kochen was Schönes, und manche bekommen sogar Kinder.
Wütend über diese Sattheit
Schon ist die Rede von der »neuen Bescheidenheit« der 30-Jährigen. In seinem Buch »Verzichten auf« ersetzt der Journalist Matthias Kalle (29) die über lange Zeit bestimmende Frage »Was bringt mir das?« durch den Leitsatz »Wie will ich leben?« Abgestoßen von der sich ausbreitenden Angst um Arbeit und Zukunft in seiner Umgebung, von der lässig oberflächlichen »Attitüde« seiner Freunde und Kollegen plötzlich genervt, wütend über »diese Sattheit, diese Angepasstheit, diese emotionale Verkrüppelung, diese Unfähigkeit zum Dialog, dieses politische Desinteresse, diese Planlosigkeit, die Kopflosigkeit, die Herzlosigkeit«, kündigte Kalle seinen Berliner Job und seine Wohnung, um sich in seine ostwestfälische Heimat zurückzuziehen und dort in sich zu kehren.
Inzwischen lebt Matthias Kalle wieder in Berlin und leitet die Redaktion des Stadtmagazins »Zitty«. Das Ergebnis seiner einjährigen »Inventur« ist als demonstrativ schlicht gestaltetes Taschenbuch käuflich. 220 Seiten Selbst- und Gesellschaftsreflexionen mit einem unangenehmen Hang zum Belehrenden. Obwohl einer von drei Teilen in Kalles Buch die Überschrift »Worauf wir verzichten sollten« trägt, ist es gar nicht so leicht, herauszufinden, was der Autor denn nun loswerden möchte, um glücklicher zu sein. Und wenn er die Dinge dann recht schwammig benennt - »die Attitüde«, »die Gleichgültigkeit«, »die Ironie«, »das Jammern« usw. -, so nimmt man es wahr, ohne recht daran zu glauben, dass er nach seiner Rückkehr aus der Provinz tatsächlich ein anderes Leben führen wird.
Immerhin, eine große Erkenntnis nimmt Kalle mit zurück ins hauptstädtische Journalistenleben: dass es »mal an der Zeit wäre, sich Fragen zu stellen, anstatt immer nur dumme Antworten zu geben«. Statt der oft ohne viel eigenes Zutun erlangten Selbstgewissheit der Vergangenheit entdeckt er den Zweifel als neues Lebensprinzip. »Zweifeln war verboten«, schreibt er über das zerbröckelte Gestern, »ein Zeichen von Schwäche und Langsamkeit«. Doch nur wer sich selbst in Frage stellt, statt seine eigene Unfähigkeit auf eine abstrakt über uns wabernde »Krise« zu schieben, meint Kalle, kann darauf hoffen, neue Wege zu finden, auf denen er - vielleicht - sogar glücklich wird.
Wer »die Krise« wie Kalle lediglich als »Orientierungslosigkeit irgendwelcher Wohlstandsbengel und schlecht gefickter Möchtegernmodels« empfindet, zählt wohl selbst zu einer dieser beiden Kategorien. Zugegeben, es gibt die »Krise« offenbar auch in dieser Gestalt. Es könnte schon sein, dass Katja Leßmeister nicht davon gesprochen hätte, dass bald »alles vorbei« sei, wenn sie nicht ihr finanziell abgepolstertes »Leben auf der Überholspur« als Normalfall betrachtet, sondern dieses Dasein auf seinen tatsächlichen Lebensgehalt hinterfragt hätte, wie Matthias Kalle es allen empfiehlt, die zu Hause sitzen und sich Leid tun. Was er jedoch vollständig ausblendet, ist die Tatsache, dass die wenigsten Opfer der »Krise« mit dem Sportwagen zu Aldi fahren.
Um auf etwas zu verzichten, muss man es erst mal besitzen. Materieller Besitz aber spielt in »Verzichten auf« kaum eine Rolle. Es scheint, dass Kalle, der doch so viel in Frage stellen will, ein gewisses Maß an Wohlstand für selbstverständlich hält, weil er es einfach nicht anders kennt.
Wer nichts hat, hat nichts zu verlieren
Anders als bei den vermeintlichen Repräsentanten meiner Generation wie Illies, Kalle, Leßmeister gibt es in meinem engeren Bekanntenkreis niemanden, dem die 90er Jahre mühelos zu Reichtum verholfen haben. Börsengeschäfte galten den meisten als unanständig, und von denen, die keine Bedenken hatten, mit Geld Geld zu verdienen, hatte kaum jemand genug davon, um sich irgendwelche Aktien zu kaufen. Glück gehabt, könnte man heute sagen. Wer nichts hat, hat nichts zu verlieren.
Auch ist kein einziger meiner Freunde von der Uni in einen gut bezahlten Job abgeworben worden, trotz Auslandssemestern, Praktika und zum Teil sehr guten Ergebnissen. Vielleicht liegt es daran, dass die meisten ihre Fächerwahl nicht nach den Karriereaussichten, sondern nach eigenen Vorlieben und Interessen getroffen haben. Wohl nicht zuletzt, weil sie ahnen, dass dem Studium der Gang zum Arbeitsamt folgen wird, hangeln sich viele meiner Freunde auch mit Ende 20 noch an der Universität von Semester zu Semester und verdienen sich ihr rares Geld mit Gelegenheitsjobs. Zum Leben reicht es allemal. Selbst mit kleinen Kindern, von denen es in meinem Umkreis trotz Arbeitslosigkeit und fehlender finanzieller Absicherung immer mehr gibt. Es geht, das haben wir dank der »Krise« gelernt, auch ohne Auto, zwei Fernseher und teure Markenklamotten.
Dass es mal eine Zeit gegeben haben soll, in der Fleiß und eine gute, zielstrebig absolvierte Ausbildung fast automatisch zu einem Arbeitsplatz führen, können wir uns kaum mehr vorstellen. Dass es Menschen gab, die vom Berufseinstieg bis zur (sicheren) Rente an der gleichen Stelle gearbeitet haben, halten wir für einen Witz. Und über Altersgenossen, die 100000 Euro jährlich verdient haben und nun um ihre Existenz bangen, können wir nur lachen. Von dem Geld, das Katja Leßmeister für ihren Sportwagen bekommen würde, wenn sie sich nur von ihm trennen könnte, würden wir monatelang ein unbeschwertes Leben führen. Wir glauben nicht an den oft verkündeten, aber immer ausbleibenden Aufschwung und halten »negatives Wachstum« für das Unwort des jungen Jahrhunderts.
Während viele derjenigen, die sich auf Grund ihrer Biografien mit der hedonistischen Lebensweise der »Generation Golf« identifizieren konnten, den wirtschaftlichen Einbruch als tiefen Fall empfinden, fällt es denen, die die Erfahrung dieser Kontinuität nicht gemacht haben und an ein stetiges Aufwärts nie glaubten, vielleicht leichter, nach anderen Wegen zu suchen und an materiellen Verlusten nicht psychisch zu zerbrechen. Auch ohne Job bleibt der Mensch ein Mensch, der gebraucht und geschätzt wird.
Suchende sind wir alle. Finden wird jeder etwas anderes. Das ist der Grund, warum wir zwar eine Altersgemeinschaft, doch keine Generation sind: Uns fehlen die gemeinsamen Ziele. Wir glauben schon lange nicht mehr an eine Wahrheit, und auch das Urvertrauen, das einige wohl seit ihrer Kindheit in die »soziale Marktwirtschaft« hatten, ist fast vollständig aufgebraucht. Die Protestbewegungen der Jüngeren und Älteren sind uns suspekt, weil wir zwar wissen, wogegen wir sind, aber nicht so richtig, wofür. Und deshalb versuchen wir die Türen, die die »Krise« uns verschlossen hat, auch nicht gewaltsam aufzubrechen: Weil niemand weiß, was dahinter zum Vorschein kommt.
Vielleicht sind wir auch nur zu feige.
Florian Illies: Generation Golf. Fischer, 218Seiten, broschiert, 9 EUR
Florian Illies: Generation Golf zwei. Blessing, 224Seiten, gebunden, 16,90 EUR
Matthias Kalle: Verzichten auf. KiWi, 222Seiten, broschiert, 8,90 EUR
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.