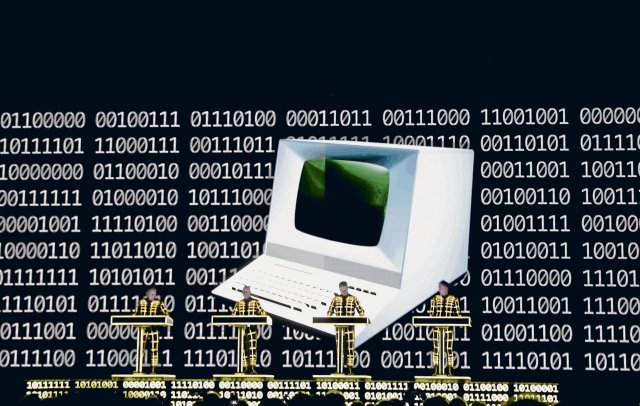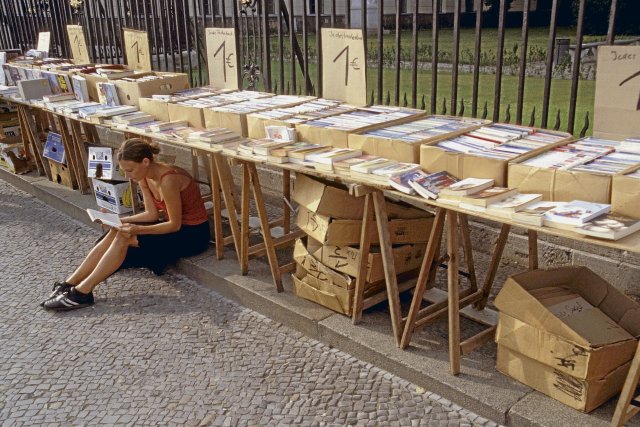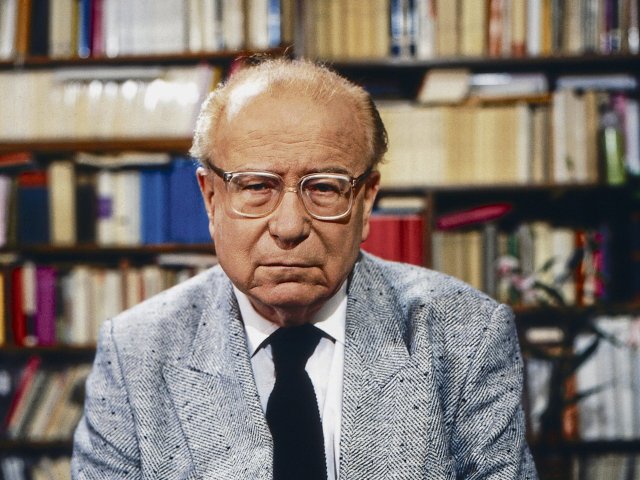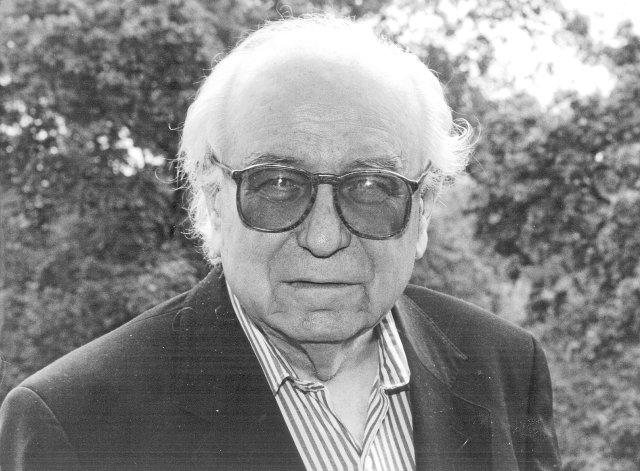Vorfahrt für den Fußgänger
bleiben, wenn dort ausreichender Raum vorhanden ist. Radfahrer, die nach links abbiegen wollen, müßten sich an sich zur Mitte der Fahrbahn bewegen und können dies auch wie ein Kraftfahrer tun.
Insbesondere bei starkem Fahrzeugverkehr auf der Fahrbahn wurden aber manche Radfahrer unsicher, wenn sie sich zwischen dem Fahrzeugverkehr zur Fahrbahnmitte einordnen sollten. Die StVO gibt daher diesen Radfahrern die Möglichkeit des „indirekten Linksabbiegens“. Der Radfahrer soll zunächst die Fahrbahn der von rechts einmündenden Straße überqueren und sodann, wie ein Fußgänger, im rechten Winkel die Fahrbahn der Straße kreuzen, die er verlassen will. Wenn es die Verkehrslage erfordert, müssen sie dabei allerdings absteigen. Ist eine Radwegführung vorhanden, ist dieser zu folgen.
Wer (links) abbiegen will, muß entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen. Dies gilt auch für Schienenfahrzeuge, die sich in der gleichen Richtung bewegen. Ist an einer
ampelgeregelten Kreuzung oder Einmündung ein grüner Pfeil links hinter der Kreuzung installiert, so zeigt dieser bei Aufleuchten an, daß der Linksabbieger freie Fahrt hat und nicht mehr mit „feindlichem Gegenverkehr“ rechnen muß.
Beim Rechtsabbiegen sind Radfahrer und Mofa-Fahrer zu beachten, die sich rechts neben dem abbiegenden Fahrzeug auf gesonderten Wegen befinden können (eine unfallträchtige Situation, da die schmale Silhouette im Rückblick kaum wahrgenommen wird). Dies gilt insbesondere bei dem aus DDR-Zeiten übernommenen „Grünen Pfeil“ für das erlaubte Rechtsabbiegen bei Rot einer Ampelanlage. 4
Im Gegensatz zur DDR-StVO fordert das Gesetz aber nunmehr zwingend, daß der Rechtsabbieger vorher anhält! Eine Verminderung der Geschwindigkeit reicht nicht aus, denn Anhalten bedeutet ein deutlich wahrnehmbares Stillstehen des Fahrzeugs. Auch wenn für den Fahrzeugführer ersichtlich ist, daß in der konkreten Situation kein anderer Verkehrs-
teilnehmer gefährdet werden kann, wird doch vom Gesetz dieses Anhalten aufgrund der im allgemeinen besonders gefahrträchtigen Situation gefordert.
Omnibusse oder ähnliche öffentliche Verkehrsmittel können sich auf gesonderten Busspuren vorwärtsbewegen. Der öffentliche Nahverkehr genießt hier Priorität vor dem Indiyidualverkehr, ihnen ist beim Abbiegen ebenfalls vorrangig Durchfahrt zu gewähren.
Eine Besonderheit gegenüber dem DDR-Recht, die sich noch nicht überall herumgesprochen hat, gilt hier gegenüber Fußgängern. Auf sie ist beim Abbiegen, besondere Rücksicht zu nehmen. Das Gesetz schreibt sogar vor: wenn nötig, muß gewartet werden. Fußgänger, die im Begriff sind, die Straße zu überqueren, in die abgebogen werden soll, haben also ein Vorrecht gegenüber dem Kraftfahrer.
Das bereits erfolgreich in der DDR praktizierte „tangentiale“ Linksabbiegen hat nun auch Eingang in die BRD-StVO gefunden. Danach ist bei entgegen kommenden Fahrzeugen, die
beide links abbiegen wollen, voreinander abzubiegen, es sei denn, die Verkehrslage verbietet es.
Von großer Bedeutung ist die Vorschrift des § 9 Abs. 5 StVO. Danach muß sich ein Fahrzeugführer beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden und beim Rückwärtsfahren ganz besonders aufmerksam verhalten, da es sich hier um ungewöhnlich gefährliche Fahrmanöver handelt. Das Gesetz verlangt: erforderlichenfalls hat er sich einweisen zu lassen.
Ein Fahrzeugeigentümer wird keinen Erfolg in einem Schadenersatzprozeß haben, wenn er z.B. rückwärts aus einem Grundstück oder aus einer Parklücke herausfährt - immer wieder zu beobachten - ohne sich einweisen zu lassen.
Es ist schlichtweg sinnlos, einen Prozeß aufzunehmen, wenn in solch einer Situation ein Verkehrsunfall passiert ist. Es findet hier nämlich eine sogenannte „Beweislastumkehr“ statt mit der Folge, daß grundsätzlich davon ausgegangen wird, daß denjenigen ein Verschulden am Unfall trifft, der eine dieser besonderen Pflichten verletzt hat, es sei denn, er kann beweisen, daß der Unfall auch sonst passiert wäre und der andere die Schuld daran trägt.
BIRGIT BAUER THOMAS SCHAUSEIL
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.