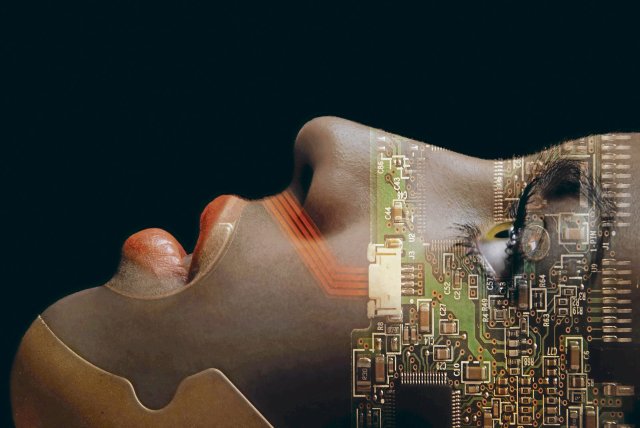Eine Nummer - mehr blieb von vielen nicht
Zwischen Oder und Spree ist Geschichte noch zum Greifen nah - doch zu wenige wollen sich ihr stellen
»Verschärft...?« Dr. Jörg Kritzler atmet tief ein, hebt die Augenbrauen. »Es stimmt, es gab an diesem Tage noch Kämpfe. Etwas außerhalb von Wriezen, doch da war längst alles klar: Der Weg nach Berlin ist frei - der Wahnsinn stand kurz vor seinem Ende!«
Kritzler erinnert sich. Vor nunmehr fast 70 Jahren wurde er in Wriezen geboren, wuchs dort auf und kam nach dem Medizinstudium wieder zurück ins Oderbruch, seine Heimat. Seit ein paar Jahren genießt er, als Pensionär tun und lassen zu können, was Geist und Körper ihm noch gönnen. Und da beide für ihr Alter noch recht freigiebig sind, marschiert er fast jeden Morgen ins Rathaus. Im ersten Stock, am Ende des Flures, hat er ein Zimmerchen. Mit Schreibtisch und Computer. Am Türschild ist Kritzlers Funktion vermerkt: Ortschronist. Ehrenamtlich sammelt und ordnet er all das, was für den Rest der Welt möglicherweise nicht allzu bedeutend scheint. Fast täglich kommen Nachbarn und bringen ihm, was zum Wegwerfen zu schade ist. Oft alte Zeitungen, deren Papier sich bereits auflöst. Immer öfter bitten ihn die Alten, die nicht mehr gut zu Fuß sind, doch mal auf einen Kaffee vorbeizukommen. So wie die 90-Jährige, die ihm jüngst zwischen Kuchen und Sahne erklärte, wieso sie »die Russen« nicht, wohl aber »die Polen« mag. Im Frühjahr 1945, als Wriezen unter Feuer geriet, wollte sie sich nicht evakuieren lassen. Plötzlich kam das, was der Großdeutsche Rundfunk am Tage des Geschehens noch in ferne Regionen log: die Front. Mit ihr ein sowjetischer Soldat, der nach Art des Häuserkampfes eine Mpi-Garbe voraus in ihr Versteck schickte. Die Kugeln verletzten sie an den Beinen. Nachrückende Soldaten einer polnischen Einheit behandelten die Wunde. Als man sie wieder nach Hause schickte, stand da ein polnischer Bursche in Uniform. Mit einem Sack Getreide. »Nimm«, sagte er. Natürlich habe alles in ihr gejubelt - doch wie sollte sie das Geschenk nach Hause bringen? Der Soldat bedeutete ihr, eine Karre zu holen. Sie eilte sich und doch sank ihre Hoffnung, den Sack mit dem Überlebenskorn noch vorzufinden. Wie ein Wunder sei es ihr vorgekommen, dass der Soldat - samt Sack - auf sie gewartet hat.
Es sind kleine Geschichten, die ein Stück des Weltengangs erklären helfen, sagt Kritzler. Am Wochenende gedachte das Land Brandenburg der Gefallenen der letzten Schlacht vor Berlin. An den Seelower Höhen verreckten Sowjetsoldaten, Polen, Deutsche.
 Fast 50 000 Menschen - gegen die und aufseiten der Tyrannei. Weil die Flanken jenes Gemetzels bis nach Wriezen reichten, kann der akribische Kritzler inzwischen weitere Nationalitäten nennen, die hier Männer in den besten Jahren zur Schlachtbank trieben: SS-Freiwillige aus den Niederlanden kämpften und starben, auch Skandinavier, ein ungarisches Polizeibataillon war im Einsatz. Auch 999er hat man ins Feuer gejagt. Und so wie auf deutscher Seite Wlassow-Leute dienten, mühten sich aufseiten von Shukows 1. Belorussischen Front Leute vom Nationalkomitee Freies Deutschland.
Fast 50 000 Menschen - gegen die und aufseiten der Tyrannei. Weil die Flanken jenes Gemetzels bis nach Wriezen reichten, kann der akribische Kritzler inzwischen weitere Nationalitäten nennen, die hier Männer in den besten Jahren zur Schlachtbank trieben: SS-Freiwillige aus den Niederlanden kämpften und starben, auch Skandinavier, ein ungarisches Polizeibataillon war im Einsatz. Auch 999er hat man ins Feuer gejagt. Und so wie auf deutscher Seite Wlassow-Leute dienten, mühten sich aufseiten von Shukows 1. Belorussischen Front Leute vom Nationalkomitee Freies Deutschland. Ortschronist Kritzler vermeidet jegliches Pathos. Er mag nicht werten, er hält sich an Fakten. Und die deuten - hüben wie drüben - kaum auf »Heldenmut«. Das gelte für den Helden der Sowjetunion Kowalenko, der zu DDR-Zeiten Ehrenbürger von Wriezen wurde, ebenso wie für Kritzlers Vater, der 1945 als deutscher Pilot umgekommen ist. »Er war Gymnasiallehrer, kein Nazi«, sagt Sohn Jörg. Er, der einst der DDR-Staatssicherheit beweisen sollte, dass er nicht gegen die DDR eingestellt ist, nur weil er in Greifswald einen Studentenstreik angezettelte, weiß um die Schwierigkeiten, etwas zu bestreiten, was evident scheint. Er fordert Einsicht: »Mein Vater wollte unsere Familie verteidigen - wie Kowalenko die seine.« Absurd!
Absurd? Spricht man mit Hitlers Landsern, schaut man in Tagebücher, denkt sich in fremdes Leben, kann man das Absurde womöglich erahnen. 1945, nachdem der Krieg mit allen Scheußlichkeiten auf sein Ausgangsterritorium zurückgekehrt war, sahen viele nur noch eine Chance: Kämpfen! Im April dachten freilich die meisten: Zum Teufel mit dem Führer! Doch was wird dann mit Volk und Vaterland?
Ein paar Kilometer südlich von Wriezen im Wald bei Kunersdorf liegen einige jener Soldaten, die keine Antwort mehr auf diese Frage fanden. Geburts- und Sterbedaten weisen sie als Familienväter oder heranwachsende Söhne aus - so man noch identifizieren konnte, was die Walze aus Feuer und Stahl, die über sie hinweggerollt ist, übrig ließ. Oft nur eine Nummer. Und so Angehörigen keinen Ort zur Trauer. Im Gästebuch des Seelower Museums steht: »Meinem Bruder, Klaus Jahnke, der nach seinem Einsatz in der Schlacht um die Seelower Höhen noch immer als vermisst gilt, an seinem 80. Geburtstag. Wir waren Geschwister - und haben uns kaum gekannt.«
Wer weiter blättert, stößt auf die dümmsten aller Nazi-Sprüche: »Ruhm und Ehre der deutschen Wehrmacht&Waffen-SS, die besten Soldaten der Welt«, hat einer hineingeschmiert. In Worte wohl gesetzt, kommt Ungeist auch subtiler herüber: »Jeder Tote hat Teile der deutschen Bevölkerung vor dem bolschewistischen Joch bewahrt. Wenn das keine Helden waren, gibt es keine Helden.« Die Rede ist von »Vorbild« und »Ansporn« Jemand hat dagegen geschrieben: »Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst« So ist Deutschland - 60 Jahre nach dem schlimmsten aller Kriege.
Kritzler ist der Letzte, der Liebe nicht dem Hass vorziehen möchte. Doch er fragt sich, wie junge Menschen verstehen sollen, was Liebe leitet und was Hass fördert. Obwohl die Medien in diesen Tagen voll sind von 60-Jahre-Gedenkberichten, fühlen sich allzu viele junge Leute nicht angesprochen. Kritzler ist enttäuscht. Nicht ein einziger Schüler des Gymnasiums - geschweige denn ein Lehrer - sei zu ihm gekommen, um zu fragen: Wie war denn das, als das große Morden durch unsere Straßen zog? Dabei könnte der 70-jährige Kritzler junge Hilfe brauchen, damit nicht noch mehr vergessen wird, was wichtig für die Zukunft ist. Voller Freude würde er bei Jahresarbeiten helfen, Projekttage mitgestalten. Auf zu viele kleine Fragen, die zum Großen führen, kann er noch immer nicht Antwort geben. Beispielsweise, wenn er nach Cesare Orsenigo gefragt wird. Der war ab 1930 Apostolischer Nuntius und verlegte - als es über Berlin Bomben »regnete« - sein Amt ins Schloss nach Prötzel. Der Ort liegt nur zehn Autominuten von Wriezen entfernt. Als die sowjetischen Soldaten an die Oder vorrückten, machte sich der Botschafter des Stellvertreters Gottes aus dem Staub. Warum half er nicht, kümmerte sich nicht um Flüchtende, um unschuldig Bedrohte? Historiker »höheren Orts« beklagen, dass Orsenigos Akten nach 1933 noch immer nicht öffentlich sind. Man mutmaßt, der Vatikan fürchtet Fragen nach Duldung der Nazi-Verbrechen.
Dass Antworten auf solche Fragen auf entsprechenden Ehrgeiz in der Region treffen, wünscht sich Kritzler. Doch er glaubt nicht daran. Etwas resigniert berichtet er von der Begegnung mit zwei jungen Nachbarinnen. Auf dem Markt wurden sie gefragt, wo denn das Wriezener Rathaus einst gestanden hat. Obwohl man die Konturen des vor 60 Jahren zerstörten Gebäudes ins Pflaster eingelassen hat, waren beide ahnungslos. Gewiss, so erklärt sich Kritzler dieses Versagen, haben die Menschen am Rande Brandenburgs heute andere, existenzielle Sorgen. Das versteht der Doktor - und fragt dennoch: »Wie will jemand sein Leben packen, wenn er nicht einmal so richtig weiß, wo seine Wurzeln liegen?!«
Während heute vor 60 Jahren im Oderbruch der letzte Widerstand erlosch, heulten in Berlin Sirenen im Fünf-Minuten-Dauerton. Kein Jubel zu »Führers« Geburtstag. Das Heulen bedeutete: »Feindalarm«! Die Rote Armee hatte Bernau erreicht, stand bei Rüdersdorf. Die letzten zwölf Tage des Wahnsinns waren angebrochen...
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.