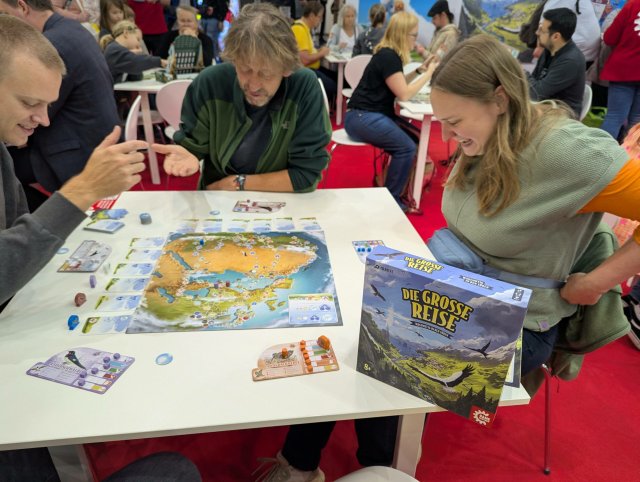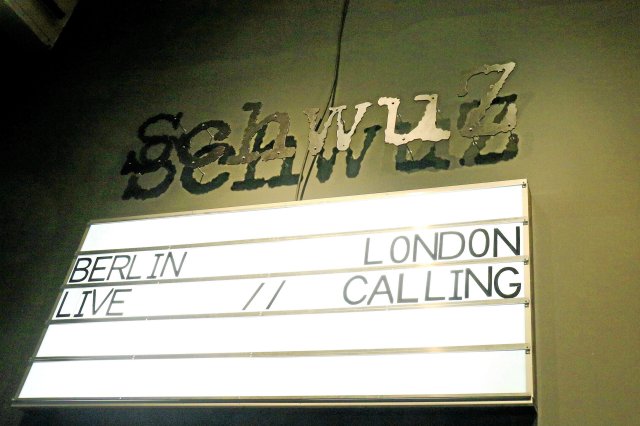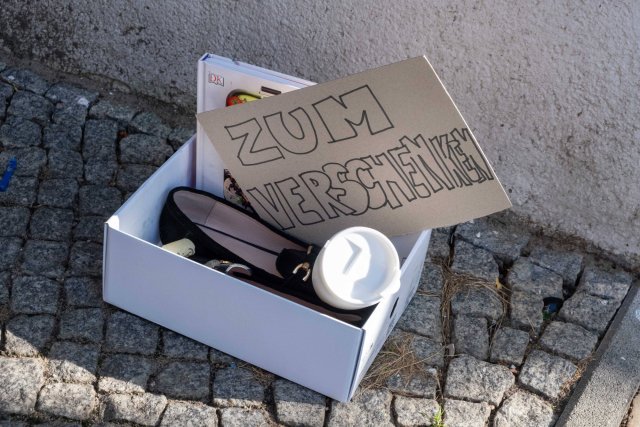Eigentum verpflichtet
Vor 75 Jahren beschwor Erich Kästner die Reichen, mehr fürs Gemeinwohl zu leisten
Mit Erich Kästner hat das insofern zu tun, als der sozialkritische Lyriker und Schriftsteller (»Emil und die Detektive«) vermögende Menschen zur Hilfe für Arme aufgefordert hat - nicht aus Mitleid, sondern im eigenen Interesse. Vor 75 Jahren erschien Kästners Gedichtband »Ein Mann gibt Auskunft«. Darin findet sich die »Ansprache an Millionäre«, eine flammende Rede in Versen, die angesichts der Diskussion um die so genannte Reichensteuer brandaktuell erscheint.
In elf Strophen versucht Kästner Millionären, heute wohl eher Milliardären und milliardenschweren Unternehmen vergleichbar, schmackhaft zu machen, Teile ihres Geldes zum Nutzen der Allgemeinheit auszugeben. Damals, in den wirtschaftlich heiklen 20er Jahren, gab es das Grundgesetz noch nicht. Mithin auch nicht dessen zurzeit viel zitierte Festlegung in Paragraf 14, Absatz 2, die da lautet: »Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.«
Auf diesen Passus letztlich stützen sich auch Teile der SPD und die Grünen, wenn sie mit einer Art Reichensteuer Spitzenverdiener mit einem Jahreseinkommen von mindestens 250000 Euro (Verheiratete: 500000 Euro) zusätzlich belasten wollen - und zwar mit einem Aufschlag von drei oder gar fünf Prozent auf die Einkommenssteuer. Dies würde voraussichtlich 55000 bis 60000 Bundesbürger betreffen, aber kaum viel mehr als eine Milliarde Euro in die Finanzkasse tröpfeln lassen.
Wie man sich denken kann, erregt dieses Ansinnen Unmut bei etlichen Betroffenen und der Wirtschaft. Die Unionsparteien sprechen von einer »Neidsteuer«; auch das oft bemühte Wort von der Neid-Debatte macht wieder die Runde. Das aber sei »albern«, findet Heribert Prantl, Autor des Buchs »Kein schöner Land - Die Zerstörung der sozialen Gerechtigkeit«. Die Annehmlichkeiten des Reichtums seien »jedem gegönnt«, schreibt der Innenpolitik-Ressortchef der »Süddeutschen Zeitung«. Doch Reichtum werde »unsozial, wenn er zum volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problem wird«. Jeder Euro, der ausgegeben werde, um Kinder aus schwierigsten Verhältnissen zu fördern, »erspart Folgekosten und verzinst sich langfristig«.
Vermeidbare Folgekosten, etwa für den Kampf gegen Verbrechen oder Verelendung, hatte auch Erich Kästner im Sinn. In seiner »Ansprache an Millionäre« verwies er darauf, dass allzu krass werdende Vermögensunterschiede jede Gesellschaft aus den Angeln heben können. »Warum wollt ihr so lange warten, bis sie euren geschminkten Frauen und euch und den Marmorpuppen im Garten eins über den Schädel hauen?«, fragt er die Reichen und fügt ähnlich drastisch hinzu. »Dann wird sich der Strahl der Springbrunnen röten. Dann stellen sie euch an die Gartenmauern. Sie werden kommen und schweigen und töten. Niemand wird über euch trauern.«
Raffiniert appelliert der in Dresden geborene Poet keineswegs an die Ehre der Millionäre, sondern an ihren Geschäftssinn. Sie sollen durch ihre Einsicht sogar noch dazuverdienen. In Deutschland gibt es viele wohlhabende Menschen, die längst erkleckliche Geldbeträge für gemeinnützige Zwecke spenden - wenn auch häufiger und üppiger für kulturelle oder wissenschaftliche als für soziale. Es sage etwas über die Wertigkeit von sozialem Engagement in der deutschen Gesellschaft aus, wenn sich das Mäzenatentum »nur in Randbereichen auf soziale Belange bezieht«, sagt der Politikwissenschaftler Ernst-Ulrich Huster, Professor für Sozialpolitik an der Evangelischen Fachhochschule Bochum. Dabei gebe es auch hier »historisch leuchtende Vorbilder« - so etwa erste Siechenhäuser in europäischen Städten, die Franckeschen Stiftungen in Halle oder das 1833 als Zuflucht für verwahrloste und verwaiste Kinder gegründete Rauhe Haus in Hamburg.
Noch herrschen in Deutschland keine US-amerikanischen Verhältnisse. »In den USA haben inzwischen 4 Prozent der Gesellschaft genauso viel Einkommen wie die 49,2 Millionen Menschen, die zu den unteren 51 Prozent der amerikanischen Einkommenspyramide zählen«, berichtet Ernst-Ulrich Huster. Dort übe »etwa ein halbes Prozent der Bevölkerung« die wirtschaftliche Macht im Lande aus. Doch fügt der Bochumer Politologe hinzu, »dass auch hierzulande Folgen zunehmender sozialer Polarisierung sichtbar werden«. So wachse insbesondere bei nicht wenigen jungen Menschen der Frust darüber, »keine Chance zu haben, ihren Anteil am Reichtum dieser Gesellschaft zumindest auf legalem Wege erhalten zu können«. Sie neideten anderen »das, was diese bekommen, sie verteufeln sozial noch Schwächere, ja, sie werden tätlich, mit zum Teil tödlichem Ausgang«, beklagt Huster.
Es kann sehr teuer, unfriedlich und hässlich werden, nicht gegenzusteuern. Der US-amerikanische Schriftsteller Tom C. Boyle schildert in seinem Roman »The Tortilla Curtain«, wie sich die Reichen Südkaliforniens hinter Zäunen und bewacht von Sicherheitsdiensten verschanzen, um das wachsende Heer der Elenden nahe der mexikanischen Grenze aus ihrem Leben zu verbannen - so gut das geht.
Sozialexperten wie Ernst-Ulrich Huster sind in Sorge wegen eines ähnlichen Trends zur Abschottung auch in Deutschland. »Nicht der soziale Diskurs über Verteilungsfragen wird in dieser Gesellschaft gesucht, sondern die Wagenburg der Reichen wird noch fester geschlossen«, kritisiert der Sozialwissenschaftler. Ihn bekümmert die »schroffe Trennung von Armut und Reichtum« in deutschen Städten. Längst hätten auch hier zu Lande private Sicherungsdienste Hochkonjunktur. Das mag schön sein, für deren Einnahmen. Schön für die Gesellschaft ist es nicht.
Ansprache an Millionäre
Erich Kästner
Wie lange wollt ihr euch weiter bereichern?
Wie lange wollt ihr aus Gold und Papieren
Rollen und Bündel und Barren speichern?
Ihr werdet alles verlieren.
Der Mensch ist schlecht Er bleibt es künftig.
Ihr sollt euch keine Flügel anheften
Ihr sollt nicht gut sein, sondern vernünftig.
Wir sprechen von Geschäften.
Ihr helft, wenn ihr helft, nicht etwa nur ihnen
Man kann sich, auch wenn man gibt, beschenken
Die Welt verbessern und dran verdienen -
das lohnt, drüber nachzudenken
Macht Steppen fruchtbar. Befehlt. Legt Gleise
Organisiert den Umbau der Welt!
Ach, gäbe es nur ein Dutzend Weise
mit sehr viel Geld ...
Ihr seid nicht klug Ihr wollt noch warten.
Uns tut es leid, ihr werdets bereuen.
Schickt aus dem Himmel paar Ansichtskarten!
Es wird uns freuen.
Auszug. Erschienen 1930 im Gedichtband »Ein Mann gibt Auskunft«
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.