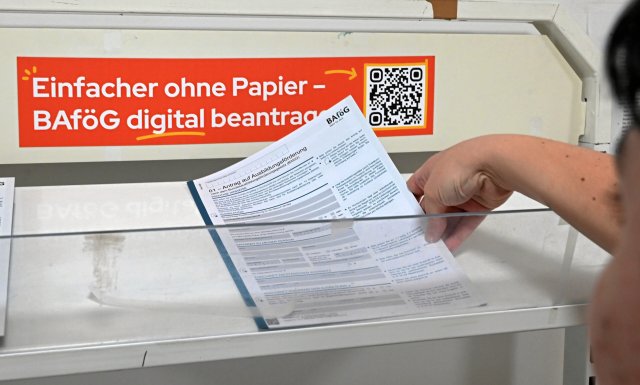- Politik
- Angela Winkler: Atemberaubender »Hamlet« in Zadeks Shakespeare-Inszenierung bei den Wiener Festwochen
Ein Mensch fiel aus der Welt
Ein Mensch ist aus der Welt gefallen. Seine Schwachstelle: das Herz. Rundum schnurrende Modernität, mordende Banalität, herzlose Effektivität. Die Welt, auf deren leerer Bühne früher, bei Beckett, ein absterbender Baum als letztes Zeichen gewesenen Lebens stand - auch diesmal, bei Shakespeare, ist diese Welt leere Bühne. Doch statt des Baumes steht da ein Container Strandgut vom Totenschiff Erde. Der Container öffnet sich - nicht für Menschen eines Königreichs, sondern für marionettenartige Versatzstücke einer totschlägerischen, blutschänderischen Ladung namens Geschichte (Bühne: Wilfried Minks). Abseits sitzt Hamlet. Sein Ort. kein Ort, nirgends. Gleich wird der Nachtwind fauchen, des ermordeten Vaters Geist erteilt den Auftrag zur Rache - am Mörder, der nun im Bett der Mutter liegt. Und ein junger Mensch Hamlet, ohnehin aus jener Welt gefallen, die nur noch ein kaltes Fest der Fremdbestimmten ist, wird weiter fallen, fallen, fallen - und ganz nah jedem Zuschauer sein, der sich noch daran aufrichten kann, daß ein androgynes Kindwesen an dieser Welt leidet. Denn der Rest, der diese Welt bildet - und das sind wir alle, sagt Peter Zadeks Theaterabend
-, dieser Rest leidet nicht mehr Lebt nicht mehr Ist nur ein bißchen damit beschäftigt, das Blut jeden Tag auf just jene Temperatur zu bringen, die Unterkühlung so verhindert wie Uberhitzung.
Shakespeares »Hamlet« erlebte eine umjubelte Premiere bei den Wiener Festwochen, und aus dem einst aggressiven, spektakelnden und knallig drastischen Zadek - er inszenierte das Stück bereits 1977 in Bochum - wurde ein verwirrend untheatralischer Regisseur, der einer rettungslos in die Simulation, ins blinde Gesellschafts-Spiel abgeglittenen Welt einen Spiegel der Ernsthaftigkeit vorhält; und als wolle er ausgerechnet das Theater als letzten Ort der Ehrlichkeit behaupten (schon daran sieht man, daß die Zeit wirklich aus den Fugen ist), nimmt er aus seiner Inszenierung alle Raffinesse heraus, alles, was nach Einfall und perfektem Ritual aussehen könnte. Dafür riskiert Zadek - auch indem er jungen Schauspielern große Chancen einräumt (Annett Renneberg als Ophelia, Barnaby Metschurat als Laertes und Rosenkranz) - den Vorwurf des Unprofessionellen, Unfertigen, Unausgespielten, Kindisch-Ungelenken.
Angela Winkler als Hamlet. Am Gürtel der Dolch, der auch Kreuz ist. Schwarze Augen, schwarzes, langes, widerspenstiges, ins Gesicht fallendes Haar, schwarz die Gestalt, aber von einem hellen Wahn,
der Ekstase und Klarheit in einem Maße zu verschmelzen weiß, daß die Grenzen von Spiel und Sein zu einem messerscharfen Grat werden. Atemberaubend.
Jene Konsequenz, mit der sich Zadek einzig und allein auf Hamlet konzentriert, hat etwas Unverfrorenes. Und zugleich geht etwas Verschworenes von einem Ensemble aus, das sich - in seiner Hochkarätigkeit - geradezu leidenschaftlich ins auferlegte Schicksal der Beiläufigkeit fügt. Otto Sander- der tapperte Königsmörder als schmallippiger, einsilbiger Intrigant, der seltsam erstaunt, verläßlich reaktionsgehemmt und beinahe abwesend registriert, daß Hamlet ihm an den Kragen seiner operettenhaften Uniform will. An seiner Seite Eva Mattes als Hamlets Mutter- eine aus dem Leim gehende Madame Butterfly, eine Drohne des ehebrecherischen Pragmatismus. Ulrich Wildgruberein staatstreu wieselnder Polonius, neurotisch kontrollsüchtig und spionierbesessen selbst gegen die eigenen Kinder Klaus Pohl: der redlich-unbeholfene Hamlet-Vertraute Horatio, Musterbild des trostvoll-nutzlosen Intellektuellen, der Hamlet und Laertes vom tödlichen Degenduell abzuhalten versucht, indem er seine Aktentasche zwischen die Waffen hält,
All diese Figuren verharren in auffälliger Gebremstheit und Geheimnislosigkeit; Zadek gibt sich kaum Mühe, ihnen
ein widersprüchliches Selbst zu geben. Aber plötzlich wirkt das Licht, das während der Aufführung im Zuschauerraum weiterleuchtet, wie eine Verbindung zwischen Bühne und Publikum, und beide Stätten offenbaren ihre Gemeinsamkeit: öffentlicher Raum zu sein, in dem Gemütserstarrung, professionelle Undurchsichtigkeit und Zurücknahme allen eigenen Wesens Spiel und Bewegungsregel sind.
In dieser unserer Welt ist Angela Winklers Hamlet der gequälte, sich quälende Alpträumer vom anderen Stern. Daß sie in ihrem traurigen, trotzigen, fuchtig aufschreienden und kindlich aufstampfenden Umherirren, in ihrem tranceartigen Getriebensein und rauhen Aufbegehren immer wieder an die Rampe tritt, ins Publikum fragt, sich uns anvertraut und sogar - in einer Lederjacke, die sie zur Anarchistin oder Kommissarin macht flammend appelliert - es scheint wie eine letzte Hoffnung zu sein, daß da doch noch ein instinktiv erfühlter Unterschied sein könnte zwischen uns Zuschauern und denen da im Stück; und immer wieder muß sich dieser Hamlet erst einen Ruck geben, um zurückzukehren ins Rollenspiel.
Die Winkler schuf eine Gestalt, die einer theatergeschichtlichen Befreiungstat gleichkommt. Hamlet ist ein Mensch, frei von Interpretationsbelastung, er ist keine Prinzipverkörperung mehr, sondern »einfach nur« ein in allen Fasern seines Daseins tief angegriffenes Wesen. Von einer fernen Innerlichkeit und einer zugleich fest geerdeten, also unglücklichen Liebes- und Lebenssehnsucht, daß man diesen immer wieder fordernden, so oft überforderten Shakespeare-Helden fortan gerettet weiß vor jeder philosophischintellektuellen Anmaßung durchs Regietheater
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.