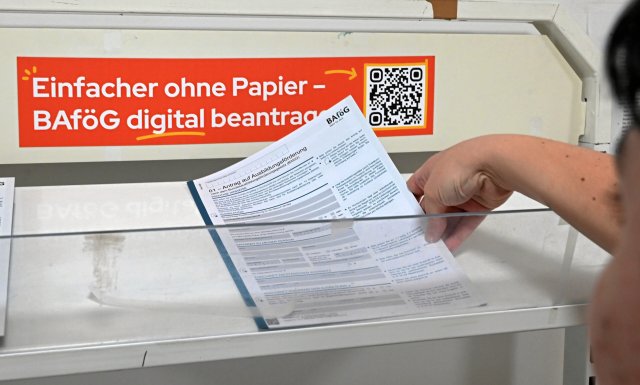- Politik
- Niedrige Einkommen
Frankreich: Armut verändert ihr Erscheinungsbild
In Frankreich leben laut der Hilfsorganisation SCCF 9,8 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze

Frankreich ist dank seines gesellschaftlichen Modells eines der Länder in Europa mit einer vergleichsweise guten sozialen Absicherung, doch Armut und Prekarität gehören nach wie vor zu den elementaren Realitäten. So heißt es in einem aktuellen Bericht der Hilfsorganisation Secours Catholique-Caritas France (SCCF), 9,8 Millionen Menschen lebten unter der Armutsgrenze, die bei 60 Prozent des mittleren Einkommens oder 1288 Euro für eine einzelne Person im Monat liegt. Das 1946 gegründete katholische Hilfswerk mit Sitz in Paris beruft sich auf die aktuellsten Zahlen des Statistischen Amtes INSEE, die sich auf Erhebungen von 2023 stützen.
Statistisch wird die Problematik erst seit Mitte der 90er Jahre verfolgt. 1994 brachte SCCF den ersten Jahresbericht heraus. Erst zwei Jahre später gab es Zahlen von INSEE, als der Kampf gegen Armut und die dadurch bedingte soziale Ausgrenzung von der Regierung zu einem nationalen Anliegen erklärt wurde. Während der Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung von 14,3 Prozent im Jahre 1996 auf 12,3 Prozent im Jahr 2004 sank, stieg er danach wieder an, um 2022 die Marke von 14,5 Prozent zu erreichen und dann bis 2023 sogar einen Sprung auf 15,4 Prozent zu machen.
Doch die Formen der Armut und das Profil der betroffenen Teile der Bevölkerung hätten sich in den vergangenen 30 Jahren durch die ökonomischen, sozialen und demografischen Veränderungen und die aufeinander folgenden Krisen gründlich gewandelt, stellt der SCCF-Bericht fest. »In diesen Jahren ist die Armut nicht wesentlich zurückgegangen, aber ihre Natur, ihr Erscheinungsbild und ihr Charakter haben sich verändert«, wird darin konstatiert. Besonders betroffen seien nach wie vor insbesondere Arbeitslose und Rentner, Geringverdiener mit einem prekären Arbeitsverhältnis sowie alleinerziehende Mütter oder Väter, aber auch jugendliche Berufsanfänger ohne oder mit geringer Ausbildung.
Armut bedeutet nicht nur geringes Einkommen, sondern auch vielfältige materielle Probleme im täglichen Leben, erläutern die Autoren. Man heizt unzureichend, ist mit seinen Rechnungen im Rückstand, ernährt sich nicht ausreichend oder ausgewogen und konsultiert Ärzte möglichst selten oder gar nicht. Eine immer größere Rolle spielt demnach das Bedürfnis der Betroffenen, ihre armutsbedingte Isolierung zu überwinden und wieder mehr sozialen Kontakt zu finden.
Im Gegensatz zu einer weitverbreiteten Meinung gibt es keine direkte Verbindung zwischen Arbeitslosigkeit und Armut, stellen die an dem Bericht beteiligten Wissenschaftler fest. In den 70er Jahren und noch bis Mitte der 80er habe es sogar einen gegenläufigen Trend gegeben: steigende Arbeitslosigkeit der Erwerbsfähigen und sinkende Armut vor allem der Alten. Danach gab es bis etwa 2015 eine parallele Entwicklung und seit etwa zehn Jahren nimmt die Armut stärker zu als die Arbeitslosigkeit. Verstärkt wurde dieser Trend ab 2020 durch die Covid-Pandemie und in den Jahren 2022 bis 2023 durch die Inflation.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Die Hilfsorganisation hat in ihrer tagtäglichen Arbeit auch eine Veränderung der öffentlichen Meinung zu den Armen im Lande festgestellt. Nachdem der Kampf gegen Armut zum nationalen Anliegen erklärt worden war, überwog bei den nicht direkt Betroffenen die Überzeugung, dass Armut konjunkturbedingt sei und in absehbarer Zeit überwunden werden könne. Als dies ausblieb, machte sich die Meinung breit, dass es eigentlich genug Arbeit und Unterstützung gebe und dass viele Arme einfach nicht genug täten, um selbst ihre Situation zu verbessern. Während nach Umfragen von SCCF die Zahl derer, die meinten, dass die Armen nur nicht arbeiten wollen, lange bei etwa 40 Prozent lag, steigt sie seit 2005 an und macht derzeit schon 60 Prozent der Befragten aus. Hinzu kam die von Rechtsextremen propagandistisch ausgenutzte starke Zuwanderung. Migranten und ihre Familien, soweit sie nicht schnell Arbeit finden und auf eigenen Beinen stehen, verstärken das Heer der Armen und Sozialhilfeempfänger.
Immer mehr wehren gegen diesbezügliche Diffamierungen muss sich auch die Organisation SCCF, für die die Hilfe für ausländische Familien eine ständig wachsende Bedeutung hat. Dabei geht es um die Beschaffung von Wohnraum und Lebensmittelhilfe, aber vor allem um Papiere wie Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis, zumal die Behörden immer unzugänglicher werden und mit Bürokratie alles tun, um hilfsbedürftige Ausländerfamilien zu zermürben.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.