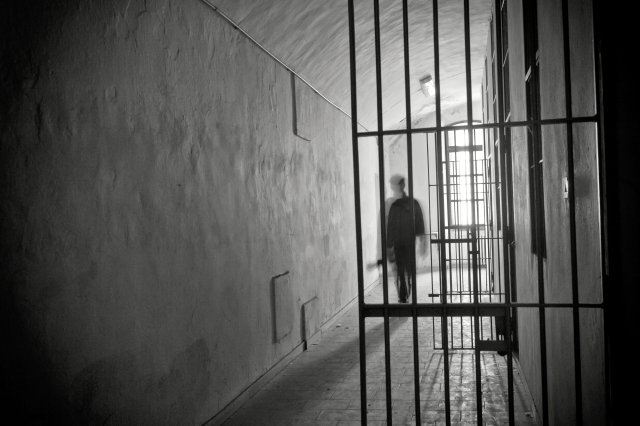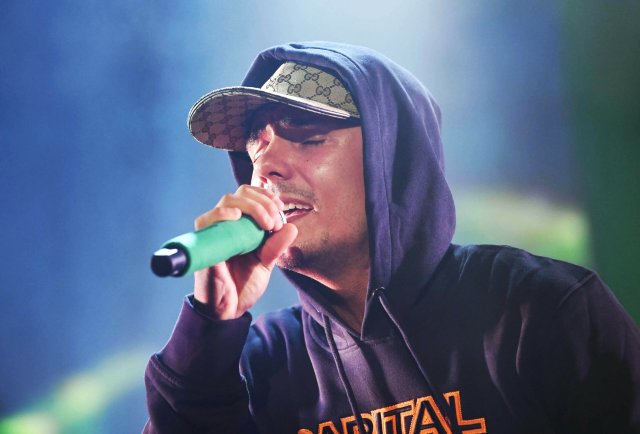Warten auf Tauwetter
Aufmerksam verfolgt Russland die georgische Politik nach dem Regierungswechsel
Moskau werde die »realen Entwicklungen in Tbilissi aufmerksam verfolgen« und auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse eine Entscheidung über die Ausdehnung der bilateralen Kontakte treffen. So jedenfalls sagte es Vizeaußenminister Grigori Karassin in einem Interview für die regierungsnahe Moskauer Nachrichtenagentur Interfax.
Bei den Parlamentswahlen Anfang Oktober in Georgien hatte das oppositionelle Wahlbündnis Georgiens Traum die Partei des Präsidenten Michail Saakaschwili besiegt. Seither stellt es den Regierungschef, den Multimilliardär Bidsina Iwanischwili, der seinen Reichtum in Russland erworben und die Normalisierung der Beziehungen zum großen Nachbarn zu einer der Prioritäten seiner Außenpolitik erklärt hat. In einer seiner ersten Amtshandlungen ernannte Iwanischwili einen Freund Moskaus zum Sonderbeauftragten für die Beziehungen zu Russland: Surab Abaschidse war früher bereits Botschafter Georgiens in Russland.
Bidsina Iwanischwili, stellte auch der russische Regierungschef Dmitri Medwedjew gegenüber der Wirtschaftszeitung »Kommersant« fest, gehöre einer anderen Generation von Politikern an als Präsident Saakaschwili. Der hatte nach dem Krieg mit Russland 2008 die diplomatischen Beziehungen zu Moskau abgebrochen, sodass die Schweiz derzeit beide Staaten beim jeweils anderen vertritt. Signale zur Wiederanbahnung von Beziehungen, wie sie jetzt aus Tbilissi kommen, erklärte Medwedjew weiter, verfolge man daher mit Aufmerksamkeit.
Es war Medwedjew, damals noch Präsident Russlands, der im August 2008 Moskaus Soldaten den Befehl zum Einmarsch in Südossetien erteilte, um den Separatisten im Kampf gegen die georgische Armee beizustehen. Saakaschwili hatte die Region, die sich bereits Anfang der 90er Jahre für unabhängig erklärt hatte, wieder unter das Dach der georgischen Verfassung zwingen wollen.
Südossetien und die Schwarzmeerrepublik Abchasien, die sich kurz nach dem Ende der Sowjetunion 1991 ebenfalls in die Unabhängigkeit von Georgien verabschiedete, sind derzeit das Haupthindernis für die Normalisierung der russisch-georgischen Beziehungen. Tbilissi betrachtet beide Regionen weiterhin als Teile Georgiens und wird darin vom Westen unterstützt. Moskau dagegen hielt von Anfang an zu den Separatisten, erkannte nach dem Krieg beide Regionen als unabhängige Staaten an, muss sie aber zwangsläufig wie Protektorate behandeln. Bei den Genfer Verhandlungen über die Sicherheit im südlichen Kaukasus, die der Lösung der Konflikte dienen sollen, bewegten sich beide Seiten bisher nicht einmal im Millimeterbereich aufeinander zu.
Weniger verhärtet sind die Fronten bei der Zusammenarbeit im humanitären und wirtschaftlichen Bereich. Zwar hatte Moskau schon im Herbst 2006 eine Wirtschaftsblockade über Georgien verhängt und das Verbot der Einfuhr georgischer Weine offiziell mit Qualitätsmängeln begründet. Schon damals waren politische Motive als eigentlicher Grund zu vermuten: Tbilissi drängte - und drängt noch heute - in westliche Strukturen wie die NATO und die EU. Dieser Tage konnte sich Russland oberster Verbraucherschützer Gennadi Onnischtschenko immerhin eine Rückkehr georgischer Weine auf den russischen Markt vorstellen.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.