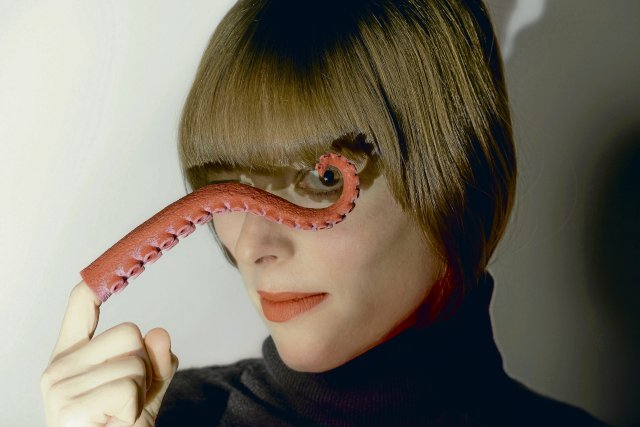- Kultur
- Politisches Buch
Für 300 Gramm pulsierendes Leben
Karl-Friedrich Lindenau - ungebührliche Betrachtungen eines engagierten Arztes
Der Vater war Schuster, die Mutter lange Zeit Hausfrau, bis die Kinder erwachsen waren; danach war sie als Kindergärtnerin tätig. An das Ende des Zweiten Weltkrieges kann sich K.-F. - obwohl damals erst vier Jahre alt - gut erinnern. In die Schule ging er gern, schreibt er. Das Abitur bereitete ihm keine Probleme, er war an die ABF Halle delegiert. Die Arbeiter- und Bauernfakultäten waren in den Gründerjahren der DDR ins Leben gerufen worden, um Kindern aus Arbeiter- und Bauernfamilien eine akademische Bildung zu erleichtern. Lindenau nutzte die Chance wie auch die nächste: ein Medizinstudium in Leningrad. Zusammen mit 159 weiteren Aspiranten brach er in eine zunächst fremde Welt auf. Wenngleich Erwartungen und Wirklichkeit nicht immer deckungsgleich, und manch Alltägliches auch gewöhnungsbedürftig waren, bereitete ihm das Studium ungetrübte Freude. Gut war das Verhältnis zu den Professoren, Dozenten und Einwohnern der Stadt. Aus der Lust Wissen zu erwerben, festigte sich bei ihm der Wunsch, Arzt zu werden, kranken Menschen helfen zu können. Anfang der 70er Jahre hatte er die Qualifikation eines Facharztes für Chirurgie an der Berliner Charité erworben. Zehn Jahre forschte und praktizierte er in dieser Klinik. Dem Herz, dem kleinen, lebenswichtigen Organ von nur etwa 300 Gramm Gewicht, galt fortan sein uneingeschränktes Interesse. Welche Bedeutung dessen regelmäßigen Schlagen zukommt, darüber erfährt mehr, wer dieses Buch zur Hand nimmt. Aber auch viel über den Pulsschlag der Zeit.
Als der Autor als Chirurg zu praktizieren begann, wurden Herzkranke in Ost und West noch auf Wartelisten gesetzt. Heute sind minimal-invasive Therapie und Knopfloch-Chirurgie sind im Brustkorbbereich alltäglich. Doch wissenschaftlicher Fortschritt hat seinen Preis, zumal in der gesellschaftlichen Ordnung, in der wir jetzt leben. Heutzutage muss sich alles rechnen. Auch die Arbeit am und mit dem Kranken.
Wie man mit den Eliten der DDR nach der »Vereinigung« umging, schildert Lindenau nüchtern, sachlich. Seit September 1983 war er Klinikdirektor und Ordinarius für Herzchirurgie in Leipzig. 1986 erfolgte unter seiner Leitung die erste Herztransplantation. Jährlich wurde in etwa 1000 Eingriffen Schwer- und Schwerstkranken geholfen. Doch all das sollte bald nichts mehr zählen: Am 26. Mai 1992 erhielt er ein förmliches Schreiben: »Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lindenau, hiermit kündige ich Ihnen das Arbeitsverhältnis mit dem Freistaat Sachsen gemäß § 54 des Bundesangestellten-Tarifvertrages. Das Arbeitsverhältnis endet mit dem Ablauf des Tages, an dem Ihnen das Schreiben zugeht.« Das geschah am 2. Juni. Unterschrieben war die Entlassung vom verantwortlichen Minister des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, Hans-Joachim Meyer. Der Grund für die rüde Abfertigung eines exzellenten Arztes aus der DDR: Staatsnähe. Ein Schicksal, das Tausende erfahren sollten. Allein in Sachsen wurden vom 1. Januar 1990 bis zum 1. Juli 1993 über 2000 Hochschullehrer vertrieben. Lindenaus Kommentar: »Es wurde nicht Platz benötigt für neues Denken, sondern für altes Personal aus dem Westen, das sich schon lange in der Warteschleife befand.«
Fachkollegen im Westen wussten um Lindenaus Qualifikation, um sein uneigennütziges Engagement für die Patienten, seine Integrität - und nahmen ihn sofort auf. Er fand in Unterfranken in einer großen Klinik beruflich und familiär neues Glück und neue Freunde.
Er hat Ungerechtigkeit erfahren - und doch schmerzte es ihn erneut, als er vor nicht allzu langer Zeit in einem ärztlichen Fachjournal lesen musste: »Das Regime - gemeint ist die DDR - hat fast ein halbes Jahrhundert die Menschen verzwergt, ihre Bildung verhunzt. Ob sich dort heute einer Jurist nennt oder Ökonom, Pädagoge, Psychologe, Soziologe, selbst Arzt oder Ingenieur, das ist völlig egal. Sein Wissen ist auf weiten Strecken völlig unbrauchbar.« Ist soviel Arroganz, Ignoranz, ja Dummheit eigentlich noch zu toppen? Die zitierten Zeilen stammen von Arnulf Baring, viele Jahre Professor für Politikwissenschaft und Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin. Um ihm und seinesgleichen nicht die Deutungshoheit über die Geschichte der DDR zu überlassen, bedarf es Bücher, wie das von Karl-Friedrich Lindenau.
Karl-Friedrich Lindenau: Ungebührliche Betrachtungen eines Mediziners. Verlag am Park, Berlin. 266 Seiten, br., 14,90 Euro.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.