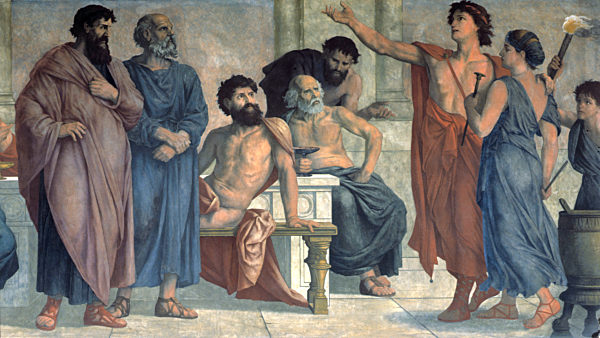Chance für das Menschsein
Ballett-Uraufführung in Cottbus: »Le sacre du printemps« nach der Musik von Strawinsky
Was da anfangs vor die Augen tritt, scheint wie die Leere nach der Zerstörung der heiligen Stadt Jerusalems, geknüpft an den Untergang der ganzen Welt. Es gibt keine Menschen mehr, nur noch Objekte, als hätten Neutronenbomben schon im Jahr 70 vor der Zeitrechnung den judäischen Staat entvölkert. Die Bühne, fahl belichtet und bespielt mit Science-Fiction-Klängen, suggeriert: Leichen liegen unterm Abhub der Zivilisation. Allein schmutzige Stoff-Fetzen, von Menschenhand genäht, türmen sich, bedecken den Boden. Brache der Gegenwart. Dreck statt Zierde, Sackleinen anstelle des Prachtgewandes. Darunter Tote, denen das Leben eingeschrieben ist. Sie, allein gelassen, einsam, verkrüppelt, beladen mit Ängsten und apokalyptischen Vorstellungen, kriechen hervor und scheinen ein totales Geschehen zu deuten, das sich körperlich je verschieden Durchbruch verschaffen will.
Es ist meine Welt, es ist unsere Welt, die untergegangen ist. Und es ist allemal eine neu zu erschaffende Welt. Bitter ernst und philosophisch ist, was dieses Ballett von Lars Schreiber und Jacob Steinberg zeigen will: Es geht um diese eine Welt in den apokalyptischen Fantasien oder Albträumen, aber nicht um den Untergang der objektiven, physikalischen Welt. Alles, was heranzogen wird, was den Menschen zur Orientierung gedient hat, was ihnen Hoffnung gab im Dunkeln, was sie aufschauen ließ zu ihren Idealen, alles scheint jetzt zerstört, nichts von alledem bietet mehr irgend einen Halt, im Gegenteil, es fällt zerstörerisch auf diejenigen, die einmal daran geglaubt haben, zurück. Und die Zeit rückt nahe, in der nichts mehr wächst. Eine Warnung also und zugleich ein Hoffnung. Denn nichts scheint dem Menschen unmöglich. Im Guten wie im Bösen.
Kann das Experiment des Lebens auf jeder Stufe noch einmal neu beginnen? Es könne. Dies die Botschaft des eindringlichen Balletts »Le sacre du printemps« nach der Musik von Strawinsky mit acht Tänzern (die religionsgeschichtsmächtige Zahl sieben bleibt außer acht), das in Cottbus zur Uraufführung kam. Jenes Chaos der Textilien verdankt sich übrigens der Initiative einer hilfreichen Cottbuser Bürgerschar, die das Material spendete. Stoff als Metapher, gut, sie gewählt zu haben, hat ihre biblischen Entsprechungen. Die Welt sei in der Vorstellung der Apokalyptik alt geworden wie ein Tuch, das man zulange als Kleid getragen hat, sagt Eugen Drewermann. Und nun sei es zerschlissen, man könne es nicht mehr flicken, nicht mehr reparieren. Es ist zu Ende. Das gehe nur, indem etwas Neues an die Stelle gesetzt wird. Im 2. Kapitel bei Markus könne Jesus sagen, seine eigene Botschaft sei derart neu, dass man sie nicht als Flicken nehmen könnte, um sie auf das alte Tuch zu setzen. Ein neuer Tuchteil würde das alte Gewebe nur zerreißen, weil er viel zu fest ist. So kann man nicht flicken. Diese Ansicht teilt die Inszenierung.
Neu geboren können die Acht aus dem irdischen Stoffmüll hervorkriechen dank eines Moduls, das sie wiedbelebt. Acht getanzte Figuren haben ihre je eigene Charakteristik. Nacheinander betreten sie die Welt, während es um sie herum leise rauscht und pulsiert (Klanginstallation Thomas Sander). Da kommt der Pionier, bereit, dem Rest der Welt die erst schlaffe, dann immer robustere Kraft seiner Arme und Beine nicht zu verweigern. Der Schneemann, einer der stärksten, agilsten der Crew. Die anmutige Amina, das Pärchen, dessen Herz höher und höher schlägt, während es um sie herum bedrohlich wirbelt. Den Reigen ergänzen die Brille, die Kira und die Mutter, deren Entsetzen über das in ihren Händen zerfallende Baby sich in den letzten Nerven ihrer behenden Körperlichkeit abbildet.
Plötzlich große Aufräumarbeit. Die Fetzen fliegen nur so und türmen sich unter den Händen der Acht zu einem Haufen. Ein halbrunder Käfig, vornehm, gülden, tritt ins Licht. Darin die beiden Pianisten, berockt wie budddhistische Mönche, ihren Strawinskypart (Flügel zu vier Händen) aufs Eifrigste musizieren, wozu sich die Schlankheit, Klarheit und Synchronität des Tänzerischen schlüssig gesellt. Ein Neues vollzieht sich, etwas, das selbst dann gefährdet scheint, tanzt und singt es sich freudig aus. Alle acht Tänzer agierten bewundernswert auf der Höhe klassischen wie modernen Ausdrucks. Die beiden Pianisten musizierten selbst bei schwierigsten Rhythmen beherrscht und souverän. Das Ende verklammert die losen Bande der Acht wie auf einem Foto zu einem bitter ausschauenden Kollektiv zusammen, in dessen Antlitz die Angst wohnt, welche die heutige Epoche untrüglich bestimmt.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.