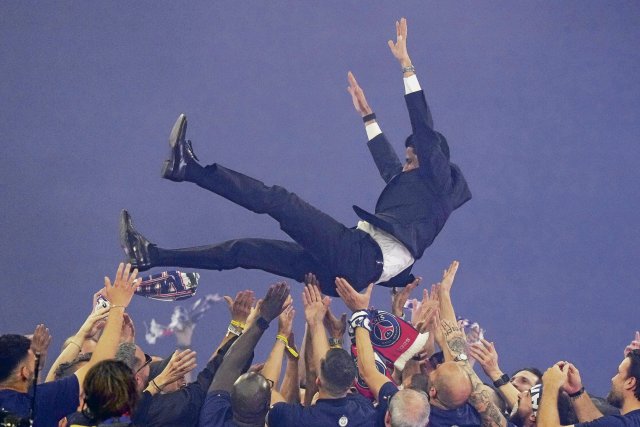Vor 60 Jahren, am 22. März 1946, ist Clemens August Graf von Galen gestorben. Als geschichtliche Figur entzieht sich Galen, von 1933 bis 1946 münsteraner Bischof, allerdings einfachen schematischen Einordnungen. Eine Annäherung an den »Löwen von Münster«.
Der Reichspropagandaminister mag innerlich jubiliert haben, als er seinen lüsternen Rachefantasien freien Lauf ließ: Wenn erst einmal der Endsieg eingefahren sei, werde man Clemens August Graf von Galen, den Bischof von Münster, auf dem Platz vor seinem Dom hängen und die Gläubigen dem öffentlichen Blutgericht beiwohnen lassen, zur Abschreckung und Einschüchterung. Vorerst allerdings, konterte Joseph Goebbels ähnliche, kurzfristigere gedankliche Vorstöße seines Parteigenossen, Reichsleiter Martin Bormann, müsse man sich gegenüber Galen noch in Zurückhaltung üben, um das katholische Münsterland nicht unnötigerweise gegen das Regime Hitlers aufzubringen
Die Überlegungen führender Nationalsozialisten im Jahre 1941, wie mit Clemens August Graf von Galen weiter zu verfahren sei, markieren den Punkt, an dem die Geduld der braunen Machthaber mit dem »Löwen von Münster« definitiv ihr Ende gefunden hatte. In allzu offenen Worten hatte der katholische Würdenträger unmittelbar vorher den Terror des Naziregimes angeprangert. Allzu sehr hatte er den Nationalsozialisten den Spiegel vorgehalten, öffentlich und zu allem Überfluss auch noch öffentlichkeitswirksam. Galens Schicksal war besiegelt - dessen Exekution lediglich aus Opportunitätsgründen auf spätere, passendere Zeiten verschoben. Am Ende kam es anders, als es sich die Nazis vorgestellt hatten.
Die Gedankenspiele Goebbels' und Bormanns machen aber auch deutlich, wie sehr Haltung und Handeln Galens nur im historischen Kontext des Nationalsozialismus und vor der Folie von NS-Diktatur und Zweitem Weltkrieg zu begreifen sind. Nur in Reaktion auf den Terror der Nazis konnte der Bischof zum »Löwen von Münster« werden. Nur in der historischen Gesamtschau werden auch die Irrungen und unauflösbaren Widersprüche Galens in ihrer ganzen Tiefe erkennbar. Irrungen und Widersprüche, die den »Löwen« Galen im Rückblick als durchaus sperrige geschichtliche Figur erscheinen lassen.
Der neue, zu diesem Zeitpunkt 55-jährige Bischof von Münster, der am 5. September 1933 ernannt und am 28. Oktober desselben Jahres geweiht wird, ist jedenfalls noch weit von einer offenen Konfrontation mit den ebenfalls neuen politischen Machthabern im Deutschen Reich entfernt. Hitler wird Galen später attestieren, anfänglich ein Freund des NS-Regimes gewesen zu sein. Die im Januar an die Macht gelangten Nazis setzen auf Galens vermeintliche Kompromissneigung und sehen entsprechend seine Ernennung zum Bischof als für sich selbst vorteilhaft. Galen ist kein Parteigänger Hitlers. Aber er lehnt den »Führer« und dessen neuen Staat auch nicht ab. Das Verhältnis zwischen katholischer Kirche und der neuen Macht sieht der Bischof, das zeigt ein Hirtenbrief Galens vom 28. Oktober 1933, noch positiv. Im Januar des folgenden Jahres versichert Galen: »Als Vaterlandsliebende stehen wir hinter dem Führer, den Gottes Vorsehung auf diesen Posten berufen hat.« Der münsteraner Bischof ist ein Nationalkonservativer, der in einer von ihm 1932 verfassten Schrift über die »Pest des Laizismus« den Gedanken der Volkssouveränität attackiert hat. Der Liberalismus ist ihm ebenso verhasst wie sozialistische Tendenzen und Freidenkertum. Jegliche staatliche Ordnung - auch die nationalsozialistische - sieht er in Übereinstimmung mit der Haltung des Vatikans als von Gott angeordnet.
Momente eines Umschwunges Galens - auf einen Kurs gegen die Nazis - werden deutlich, als der Nationalsozialismus auch gegenüber den Kirchen seine Maske fallen lässt. Als Hitler die Macht ergreift, ist er noch peinlichst bemüht, die Kirchen nicht in Gegenposition zu sich zu bringen. Er weiß, dass er seine Machtstellung nicht gegen die Kirchen behaupten kann. Nachdem die Nationalsozialisten ihr Regime etabliert und Gegner weitenteils ausgeschaltet haben, sind Rücksichten gegenüber der Kirche nicht mehr nötig. Die dem Nationalsozialismus innewohnenden so genannten neuheidnischen Tendenzen, die sich in der Rassenideologie, dem Blut-und-Boden-Denken, nicht zuletzt auch in der Person des NS-Ideologen Alfred Rosenberg verkörpern, bringen Clemens August Graf von Galen gegen die Nazi-Bewegung, nicht aber gegen den von ihr getragenen Staat auf. So sehr der münsteraner Bischof deutliche Worte gegen das Neuheidentum des Nationalsozialismus findet, so sehr unterstützt er die aggressive Außenpolitik des Hitler-Staates und seinen Krieg. »Gott hat es zugelassen, dass das Vergeltungsschwert gegen England in unsere Hände gelegt wurde«, stellt Galen im März 1941 zum Krieg Deutschlands gegen das britische Inselreich fest. »Wir sind die Vollzieher seines gerechten Willens.« Den Überfall auf die Sowjetunion begrüßt der Bischof von Münster als Kampf gegen den atheistischen Kommunismus: »Wenn ich könnte, würde ich mitgehen gegen den Bolschewismus«, bekennt er. Vier Jahre später, im Juli 1945 - in diesem Jahr kritisiert der Schriftsteller und Nobelpreisträger Thomas Mann den Bischof öffentlich als »unbelehrbaren Geistlichen«, weil für diesen die Kriegssieger Feinde bleiben -, bezeichnet Galen in einer Predigt in Telgte den Krieg Hitlers als unchristlich, da er unritterlich geführt worden sei.
Je stärker der Terror der Nationalsozialisten - zum Beispiel in Form von Klostersturm und -enteignung sowie der Vertreibung von Ordensmitgliedern - sich auch gegen die katholische Kirche und ihre Einrichtungen richtet, umso mehr erwächst den Nationalsozialisten in Clemens August Graf von Galen ein erbitterter öffentlicher Kontrahent. Reagiert Galen zunächst noch mehrheitlich auf Attacken der Nazis gegen seine Kirche, weitet der Bischof seine Angriffe schließlich auch auf die Terrormaßnahmen der Diktatur gegen andere aus.
Bereits Ende 1939 hat Hitler mit einem persönlichen Erlass ein groß angelegtes Euthanasieprogramm ins Rollen gebracht. Abgefasst im Oktober 1939 und auf den 1. September, den Tag des deutschen Überfalls auf Polen, zurückdatiert, besiegelt der Mordbefehl Hitlers das Schicksal von mehr als 100 000 geistig behinderten und seelisch kranken Menschen im Deutschen Reich. Bis zum August 1941 werden ungefähr 70 000 Patienten ermordet. Das T4-Mordprogramm ist geheim, lässt sich aber auf Dauer nicht geheimhalten.
Ende Juli 1940 erhält Galen zweifelsfreie Informationen über die Tötung von Geisteskranken. Verschiedene inoffizielle Initiativen des deutschen Episkopates, eine Einstellung der Morde zu bewirken, bleiben fruchtlos. Am 9. März 1941 prangert Galen in einer Predigt die Euthanasiemaßnahmen an. Noch deutlicher wird er in einer weiteren Predigt in der münsteraner Lambertikirche, am 3. August 1941: »Seit einigen Monaten hören wir Berichte, dass aus Heil- und Pflegeanstalten für Geisteskranke auf Anordnung von Berlin Pfleglinge, die schon länger krank sind und vielleicht unheilbar erscheinen, zwangsweise abgeführt werden. Regelmäßig erhalten dann die Angehörigen nach kurzer Zeit die Mitteilung, die Leiche sei verbrannt, die Asche könne abgeliefert werden. Allgemein herrscht der an Sicherheit grenzende Verdacht, dass diese zahlreichen unerwarteten Todesfälle von Geisteskranken nicht von selbst eintreten, sondern absichtlich herbeigeführt werden, dass man dabei jener Lehre folgt, die behauptet, man dürfe so genanntes "lebensunwertes Leben" vernichten, also unschuldige Menschen töten, wenn man meint, ihr Leben sei für Volk und Staat nichts mehr wert.« Indem Galen ausmalt, dass auch Invaliden, Altersschwache und Kriegsversehrte nach der Logik der Nazis dem staatlichen Mordprogramm zum Opfer fallen könnten, sorgt der Bischof für einen Aufruhr nicht nur unter seinen Zuhörern. Seine Predigten machen im ganzen Deutschen Reich und im Ausland die Runde, von Mund zu Mund und als heimlich vervielfältigte Abschriften. Deutlicher kann man das Unrecht, für das das NS-Regime steht, kaum benennen. Spätestens jetzt hat sich Galen die Nationalsozialisten, die die Aktion T4 wegen der Reaktion der Öffentlichkeit offiziell einstellen, zu Todfeinden gemacht.
Als »Löwe von Münster« ist Clemens August Graf von Galen schon zu Lebzeiten zum Mythos geworden. Und man tritt der katholischen Kirche nicht zu nahe, wenn man feststellt, dass es nicht zuletzt dieser Mythos gewesen ist, der die Motive und Bausteine des 1955 initiierten und im Oktober vergangenen Jahres zum Abschluss gekommenen Seligsprechungsprozesses Galens geliefert hat. In einer Seligsprechung geht es eben nicht darum, eine christliche Persönlichkeit in allen ihren Facetten auszuleuchten. Eine Seligsprechung stellt katholischen Gläubigen eine bestimmte Person als Zeugen christlichen Lebens vor Augen. Dies kann mit einer Fokussierung und, damit einhergehend, einer Reduzierung auf bestimmte Aspekte verbunden sein. Dies ist auch bei Clemens August Graf von Galen der Fall. Sein bleibendes Verdienst aber ist, wesentliche Aspekte des nationalsozialistischen Terrors klar beim Namen genannt und durch seine oppositionellen Stellungnahmen wiederum Widerstandsgruppen gegen die Nazi-Herrschaft - etwa die »Weiße Rose« um Hans und Sophie Scholl - inspiriert und ermutigt zu haben.