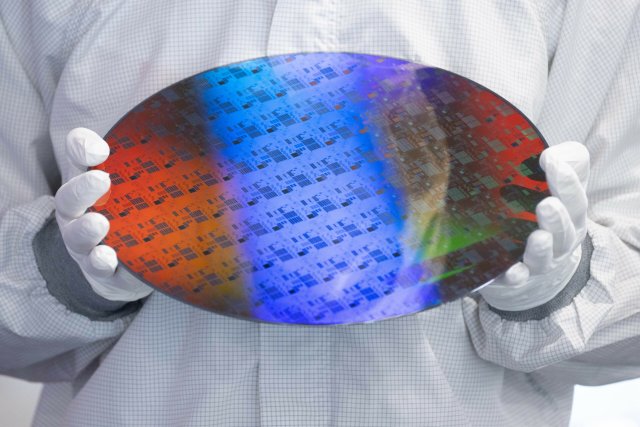Wer an Wasserkraft denkt, hat meist riesige Turbinen und Stauseen vor Augen, die »kleine Wasserkraft« wird meist vergessen. Doch auch heute noch können Wasserräder zur Stromversorgung beitragen.
Mit Mühlenromantik hat das nichts mehr zu tun: Es ist ohrenbetäubend laut in der Wasserbauhalle der Technischen Universität Berlin. Pumpen pressen zwölf Liter Wasser pro Sekunde durch den Strömungskanal. Wo sonst Küstenbefestigungen und Hafenanlagen getestet wurden, steht nun das Plexiglasmodell eines Wasserrades, das laut klappert. »Diese Geräusche sind ein Hinweis darauf, dass das Wasserrad nicht optimal eingestellt ist«, sagt Wasserbauingenieur Reinhard Marth.
»Im Allgemeinen werden Wasserräder ja eher belächelt, aber wir wollen mit der Optimierung zeigen, dass sich diese Nutzung der Wasserkraft eben doch rechnet«, sagt Reinhard Marth. Und dazu sind Modellversuche notwendig, denn im Computer lässt sich nur simulieren, worüber bereits ausreichend Messdaten vorliegen. Für diesen speziellen Wasserradtyp gibt es seit dem ersten Entwurf von 1899 keine neueren wissenschaftlichen Untersuchungen.
Zu ihrer Blütezeit um 1850 waren Wasserräder gängige Energiequellen in Europa. In Deutschland waren noch 1920 mehr als 30 000 Wasserräder in Betrieb, die heute fast völlig verschwunden sind. Nach Schätzungen könnten kleine Wasserkraftanlagen in Deutschland etwa 500 Megawatt Strom liefern, soviel wie ein kleines Kohlekraftwerk.
Es sind hauptsächlich alte Wassermühlenstandorte, die wieder reaktiviert werden könnten. Die juristische Seite ist einfach: Wassernutzungsrechte sind an das Grundstück gebunden. Diese Rechte lassen sich ohne großen bürokratischen Aufwand wieder aktivieren, selbst wenn sie schon Jahrhunderte alt sind.
Die Wasserkraft hat in Deutschland zwar den zweithöchsten Anteil nach Windkraft an den erneuerbaren Energien, trägt aber nur knapp fünf Prozent zur Stromversorgung bei. Der überwiegende Teil des Wasserkraftstroms stammt aus großen Anlagen mit Staumauern und Wehren. Diese Technik wird kaum weiter ausgebaut, da sie mit großen Eingriffen in die Flusslandschaften verbunden ist. Zudem können in ihren Turbinen Fische zu Schaden kommen; das beeinträchtigt ihren Ruf als ökologische Energiequelle. Wasserräder hingegen gelten als fischfreundlich und kosten deutlich weniger als Turbinen.
Durch die Erfindung eines Ingenieurs aus Schleswig-Holstein könnten diese Investitionskosten nochmals sinken. Das Segmentkranz-Wasserrad von Hartmuth Drews wird am Computer entworfen, ein Laser-Automat fertigt dann aus Edelstahlblechen die einzelnen Schaufelsegmente. Anstatt das komplette Rad an seinen Standort zu bringen, werden die Einzelteile erst an Ort und Stelle zusammengesetzt, um so Transportkosten zu sparen. Für seine Erfindung wurde Drews 2005 mit dem Innovationspreis des Wissenschaftsmagazins »P.M.« ausgezeichnet. »Wenn man ein Grundstück an einem alten Mühlbach hat, kommt man z.B. mit einem Wasserrad mit vier Metern Durchmesser und einer Strömung von 250 Litern Wasser je Sekunde auf eine Leistung von sieben Kilowatt, und so ein Standort macht sich nach etwa sechs Jahren bezahlt«, sagt Hartmuth Drews.
Doch auch für Firmen, die aus Imagegründen ihr Bürogebäude mit ökologischem Strom versorgen wollen, kann das Wasserrad interessant sein. So hat ein Reiseveranstalter in der Nähe von London kürzlich die Stromversorgung seines Bürogebäudes auf Wasserkraft umgestellt - die Technik stammt von der deutschen Firma Hydrowatt. Und eine Schule in Bayern möchte die Ergebnisse der Berliner Wissenschaftler nutzen, um ein Wasserrad zu installieren. Denn das Team um Reinhard Marth hat aus der alten Technik noch einen etwas höheren Wirkungsgrad herauskitzeln können.
Im Internet:
www.projekte.arteng.de/ wasserraeder/
www.wasserrad-drews.de/
www.hydrowatt.de/