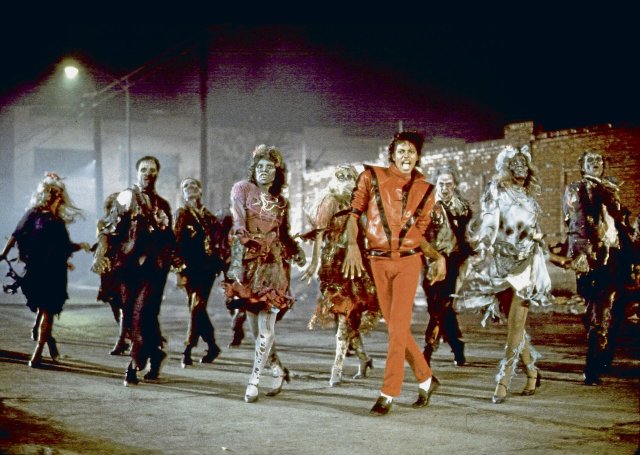- Kultur
- Reportage - Äthiopien
Die steinernen Wunder von Lalibela
»Neu-Jerusalem« in den Lasta-Bergen war Äthiopiens zweites Machtzentrum Für dessen Gründer waren Namen wie »Golgotha« und »Jordan« Erinnerung an 25 Jahre Exil 800 Jahre alte, in Fels gehauene Sakralbauten gehören heute zum Weltkulturerbe
»Lalibela« ist ursprünglich der Name des herausragenden Königs der Zagwe-Dynastie (1000 - 1270), der von 1185 bis 1211 regierte und seinen Geburtsort, der vorher Roha hieß, zur Residenzstadt gemacht hatte. Er hinterließ einmalige sakrale Bauwerke.
Gotteshäuser im Tuffsteinkessel
Der immer strahlende Atschanafi, der früher Diakon war, kennt König Lalibelas elf weltberühmte Felsenkirchen, die seit 1978 als Weltkulturerbe unter UNESCO-Schutz stehen, wie seine Westentasche. Während Ketten von Wallfahrern in weißen Baumwoll-Shammas vor uns bergauf und bergab ziehen, steigt Atschanafi mit uns in die Tiefe - in die rätselhafte Geschichte einer großen Kultur. Alles, was von der alten Lasta-Hauptstadt die letzten acht Jahrhunderte überlebt hat, liegt in drei riesigen Felströgen, die senkrecht in rotbraunes Tuffgestein gehauen sind.
Verblüffend der Anblick gleich im ersten dieser Steinkessel: Ein Bauwerk wie ein griechischer Säulentempel scheint da bis zum Dach in eine trockene Schleusenkammer gestellt zu sein. Der elf Meter hohe Quaderbau, 35 Schritte lang, 24 breit, ist von 32 Pfeilern umgeben, die ein stumpfwinkliges Satteldach aus kompaktem Fels tragen.
»Bitte Schuhe ausziehen!« Wir mischen uns unter die schweigsamen Pilger und betreten den scheinbar versenkten Kolonnadenbau »Beit Medhane Alem« - das Gotteshaus des Welterlösers. Rund 800 Jahre alt ist Lalibelas größte monolithische Felsenkirche. Im spärlichen Licht angenehme Kühle und hörbare Stille. Wir sind hinter zwei Meter dicken Außenwänden im gewachsenen Felsen und laufen über schalldämpfende Teppiche. Wenige Neonröhren erleichtern die Orientierung.
Im fast schmucklosen Kircheninneren stehen 28 quadratische Pfeiler, die die Felsdecke stützen und den Raum zu einer fünfschiffigen Basilika machen. Nur das Mittelschiff ist durch ein schlichtes Tonnengewölbe überhöht. Unglaublich! Wie Insekten, die eine Frucht von innen ausfressen, müssen die Steinmetze den freigelegten Steinquader einst ausgehöhlt haben - trotz Dämmerlicht mathematisch exakt! Nur durch die kleinen Türen und Fenster konnten sie den Abbruch beseitigen.
Vor dem Allerheiligsten, das nur durch Stoffvorhänge abgegrenzt ist, begegnen wir einem würdevollen äthiopisch-orthodoxen Priester. Er trägt ein golddurchwirktes Brokatgewand und hält ein vergoldetes liturgisches Kreuz vor sich. Es ist das so genannte Lalibela-Kreuz, dessen Miniaturausgabe christliche Äthiopierinnen manch-mal auch an der Halskette tragen. Vor acht Jahren - übersetzt Atschanafi den Geistlichen aus dem Amharischen - wurde ihm das heilige Kreuz aus seiner Kirche gestohlen. Für 25 000 Dollar tauchte es im belgischen Antiquitätenhandel wieder auf. Zwei Jahre später konnte es auf Staatskosten zurückgekauft werden. Am Tag seiner Rückkehr in die Erlöserkirche - am 21. Mai - feiert man jedes Jahr einen Dankgottesdienst.
Schuhe an, und weiter durch den Kessel, wo es noch vier andere in Stein gehauene Gotteshäuser gibt. Nur halb so groß wie die Erlöserkirche ist »Beit Mariam«, die Marienkirche. Ihre Besonderheit sind drei quadratische Vorhallen und Reste einer farbigen Innenausmalung. Zu einem Trio verschachtelt und auf verschiedenen Ebenen liegen die Kirchen »Golgotha« - eine Nachbildung der Grabeskirche in Jerusalem - und »Berg Sinai« sowie die Dreifaltigkeitskapelle. Erreichen kann man sie nur durch ein Auf- und Ab-Labyrinth von schmalen Gängen und gehauenen Stufen, die die Pilger zum Gänsemarsch zwingen.
Zehn Minuten entfernt, auf einem Felsbuckel mit wenigen alten Olivenbäumen, öffnet sich das nackte Vulkangestein erneut. Vorsicht! Ein jäher Absturz von 15 Metern! Vor unseren Füßen ein quadratisches Becken, groß wie zwei Tennisfelder, ohne sichtbaren Zugang. In der Mitte eine freistehende Plattform, darauf drei erhabene, ineinander gelegte Steinkreuze. Das ist das flache Kreuz-Dach von »Beit Georgis«, Lalibelas schönstem und künstlerisch vollkommenstem Monolith-Bau. Durch einen Graben, der zum Tunnel wird, erreichen wir die Sohle des Felsschachtes und den Eingang der Georgskirche. Bereits im August 1520 stand hier Pater Francisco Alvarez. Als Mitglied der ersten Gesandtschaft Portugals war er nach Äthiopien gekommen und blieb für lange Zeit der einzige Europäer, der Lalibelas Felsbaukunst gesehen und beschrieben hatte.
Wer noch zu den restlichen fünf Felsenkirchen pilgert, geht mit Sicherheit über den Jordan. Denn jenseits des Bergbaches - unweit des Ölbergs - liegen in der dritten Felsmulde die Bethlehem- und die Emanuelkirche sowie die Gotteshäuser Merkurios und Abba Libanos. Und wie eine mittelalterliche Festung mit Graben und Brücke mutet die gewaltige Fassade der 16 Meter hohen Gabriel-Rafael-Doppelkirche an. Sie könnte einst der Herrschersitz gewesen sein.
Der königliche Kirchenbauer war gerade erst geboren, da sah seine zu Tode erschrockene Mutter, wie sich eine dunkle Wolke auf die Wiege ihres Baby-Prinzen herabsenkte. Doch der Bienenschwarm, in dem sie fliegende Engel erkannte, ließ den Kleinen unversehrt. Deshalb nannte sie ihn »La-li-be-la« - »der von den Bienen (als Herrscher) Auserkorene«. Sein älterer regierender Halbbruder fürchtete bald um seine Krone und vergiftete den heranwachsenden Auserwählten. Doch der war nur drei Tage und Nächte lang gelähmt, während ihn Engel in den Himmel hoben, wo Gott zu ihm sprach, dass er ihn fortan führen werde: Er solle nach dem Schlaf nach Jerusalem fliehen, von wo er eines Tages als König zurückkehren werde, um in seiner Heimat wunderschöne Kirchen zu bauen, die nirgendwo ihresgleichen haben werden. Alle Pläne habe ihm der Allmächtige selbst gegeben - erzählt die Legende.
Zu den Nachtschichten kamen die Engel
Historisch belegt ist: Prinz Lalibela, geboren 1140, lebte tatsächlich von 1160 bis 1185 in Jerusalem. Nach seiner Rückkehr eroberte er den Thron und begann mit dem Kirchenbau. Bis heute rätselt man, wer seine Baumeister waren: Verfolgte Kopten aus Ägypten oder gar Tempelritter, jene Kreuzfahrer, die auch durch ihre Bautradition bekannt wurden? Lalibela könnte sie aus Jerusalem mitgebracht haben, wie unlängst der britische Ostafrika-Autor Graham Hancock nachzuweisen versuchte.
In nur 24 Jahren sollen die Bauleute die Wunder aus dem Fels der Lasta-Berge geschlagen haben. Das ging deshalb so schnell, heißt es, weil die Nachtschichten von Engeln übernommen wurden. Heutige Ingenieure rechnen mit einer Bauzeit von gut 100 Jahren.
Auf Schritt und Tritt durch das Kirchenviertel der alten Königsstadt verwundert die verpflanzte Topographie des Heiligen Landes. Doch für den Stadtgründer Lalibela waren Namen wie »Golgotha« und »Jordan« Erinnerungen an 25 Jahre Exil und zugleich - so vermuten Äthiopisten - das Programm für die eigene Hauptstadt, die als »Neu-Jerusalem« Äthiopiens zweites Machtzentrum werden sollte. Denn das erste, das tausendjährige Aksum, die 500 Kilometer nördlich gelegene Wiege der äthiopischen Zivilisation - war inzwischen durch Feindeinfälle zerstört und politisch bedeutungslos geworden. Obwohl die christlichen Zagwe-Herrscher an diesem Niedergang beteiligt waren, verstanden sie sich als Erben des aksumitischen Reiches und seiner Kultur.
Lalibelas Felsenkirchen gelten als zweiter Höhepunkt in der Kunstgeschichte Äthiopiens. Sechs weitere Jahrhunderte dynastischer Kämpfe mit endlosen Zerstörungen und Verlegungen der Machtzentralen vergingen noch, bis 1887 der Bau der heutigen Hauptstadt Addis Abeba begann.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.