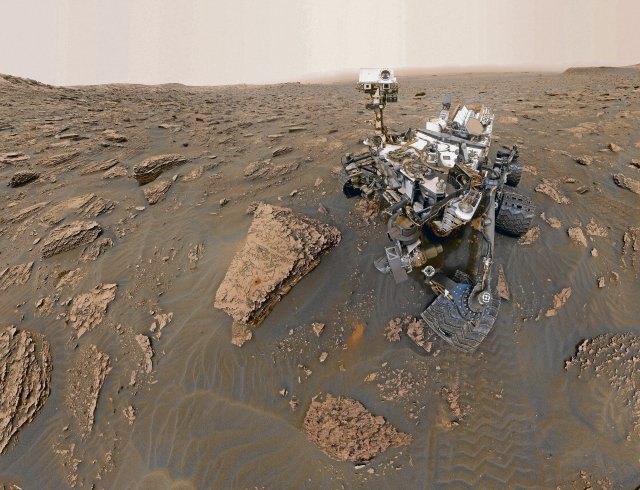Ankommen im neuen Deutschland
Im Kino: »Zonenmädchen« von Sabine Michel dokumentiert Lebenswege nach der Wende
Nach dem Fall der Mauer waren sie eine Zeit lang unzertrennlich. Heute teilen sie außer ihrer Herkunft aus der DDR und ein paar gemeinsamen Schuljahren nicht mehr viel. Das jedenfalls ist das Fazit, zu dem Regisseurin Sabine Michel am Ende von »Zonenmädchen« wohl kommen muss. Dabei waren Vera, Verusha, Claudi und Claudia ihre ersten richtig engen Freundinnen in ihrer späten Dresdner Schulzeit. Gemeinsam ging man nach dem Abitur - dem letzten einer DDR-Schulklasse - nach Paris, jobbte dort als Au pair und träumte von ganz neuen Welten.
Paris hat drei der fünf bis heute nicht losgelassen: Die Regisseurin kehrte Mitte der Neunziger Jahre zurück, um einen Teil ihrer Ausbildung an der Pariser Filmschule zu absolvieren, Freundin Claudia ist als Anwältin in Sachen Restitution enteigneter jüdischer Kunstschätze zwischen New York, Paris und Berlin unterwegs und hat ein Büro (und eine Wohnung) in Paris. Und Freundin Vera blieb gleich ganz, lebte bald zwei Jahrzehnte mit einem französischen Partner zusammen und nahm sogar die Staatsbürgerschaft an. Über ihre Herkunft aus dem »anderen«, dem östlichen Deutschland habe sie ihren Schülern bisher nie erzählt, berichtet Vera vor der Kamera, aber nun sei sie wohl bald so weit, es endlich zu tun.
Dass sie mit ihren Abiturklassen nicht nur westdeutsche, sondern auch DDR-Literatur liest, ist anscheinend bisher niemandem als ziemlich eindeutiges Indiz aufgefallen (denn das ist es wohl leider). Ein New Yorker Kollege habe ihr die Frage, ob er ihr einen Fall auch dann übertragen hätte, wenn er vorab von ihrer Dresdner Kindheit gewusst hätte, mal ohne zu zögern mit »nein« beantwortet, berichtet Claudia, die dabei überhaupt nicht aussieht, als müsse man sich Gedanken über einen etwaigen Mangel an Kompetenz machen. Die ostdeutsche Herkunft, ein Stigma, das man besser verschweigen sollte? Sie habe sich lange geschämt, darüber zu reden, stellt eine fest, man sei sich so unbedarft vorgekommen.
Die Regisseurin selbst beginnt die Filmerzählung damit, dass sie in Berlin-Mitte wohne - Berlin-Mitte, das sei früher auch mal die Mitte der DDR gewesen. Nach dem gemeinsamen Paris-Aufenthalt versuchte sie gar nicht erst, in der fremden neuen deutschen Heimat Fuß zu fassen, sondern erfand sich ein neues Leben in Portugal. Mit portugiesischem Mann und portugiesischer Tochter fand sie sich dann irgendwann als Hausfrau am Herd wieder - und zog mitsamt der Tochter nach Berlin. Vera, der Französin, blieb die Bundesrepublik schon deshalb fremd, weil sie in Frankreich lebt. Während der gemeinsamen Reise nach Dresden - zuerst traf man sich für den Film noch in Paris - sucht sie vergeblich nach der nagelneuen Plattenbausiedlung, in der sie ihre Kindheit verbrachte. Doch die ist längst als unvermietbar rückgebaut.
Die stoppelhaarige Verusha berichtet von Depression und Studienabbruch: zu groß die Veränderungen, zu vielfältig die neuen Möglichkeiten. Sie lebt als einzige heute noch in Dresden, führt sehr erfolgreich eine Kneipe - und heiratet gegen Ende des Films ihre Lebensgefährtin. Also doch immerhin etwas, das erst durch Wende und Wiedervereinigung (und ziemlich viel soziales Umdenken auch im Westen der Republik) überhaupt möglich wurde. Eine bedauert heute, allzu früh Kinder bekommen und ihre Jugend nicht genug für sich genutzt zu haben. Eine andere trennte sich vom Partner, weil der keine Kinder wollte, und ist mit Anfang vierzig auf der Suche nach einem neuen, kinderwilligen Mann.
Es mag an der Präsenz der Kamera liegen, die zugespitzte Argumente geradezu herausfordert, weil irgendetwas ja »passieren« muss, wenn sie schon zuguckt - aber viel Konsens über das Leben und ihre persönlichen Lebensentwürfe will sich unter den fünf Frauen heute nicht mehr einstellen. Die eine redet vom Kapitalismus, von dem man ja früh gewusst habe, dass er sicher nicht alleinseligmachend sei. Die andere korrigiert: Man solle doch lieber von Marktwirtschaft sprechen, denn Kapitalismus als Feindbild, das höre sich doch an, als habe man das Marxismus-Leninismus-Handbuch nie hinter sich gelassen.
Die Regisseurin, die zu Beginn von ihrer staatstragend-angepassten Kindheit erzählt hatte, entdeckt im Interview mit ihrer Mutter zu ihrem Entsetzen, woher die Angepasstheit kam. Einen Nazi-Großvater hat die Mutter verschwiegen, die lieber linientreue Texte schrieb als solch einen Vater zuzugeben. Als Tätertochter wollte sie besonders konform sein, bloß nicht auffallen. Oder wenn, dann nur im positiven, im »zuverlässigen« Sinn. Zur Belohnung durfte sie drei Jahre nach Afrika, wo ihre Tochter das Meer so liebte und ihr Mann Naturwissenschaften unterrichtete. Aber die Täter, das waren doch die anderen, die im Westen, stottert die entnervte Tochter und fragt, wie man ihr so etwas habe verschweigen können. Ein Augenblick, in dem man die Mauer im Kopf geradezu fallen hören kann: so anders waren wir also gar nicht.

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.