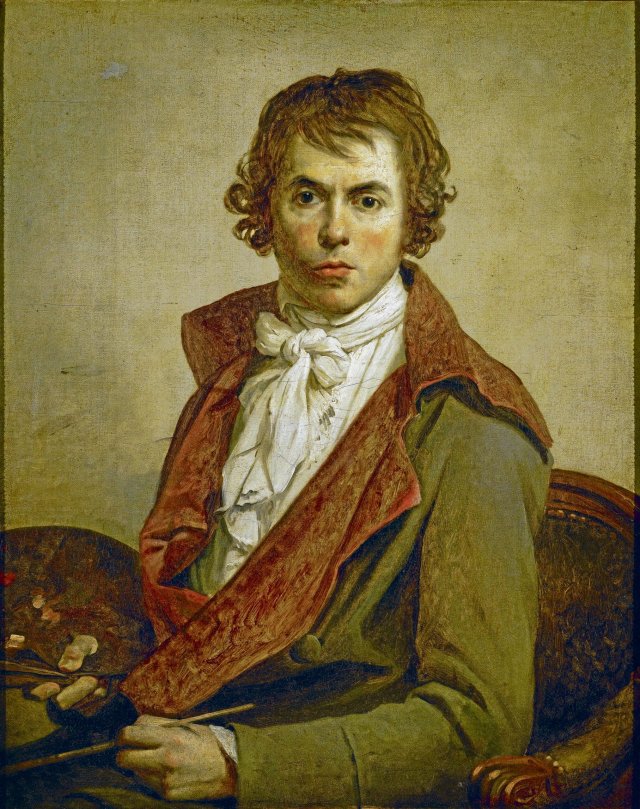Kreatives Chaos
Sozialstudie zum Punk
Eine sozialwissenschaftliche Studie zum Punk ist über die ohnehin großen Schwierigkeiten der Beschreibung einer Subkultur hinaus problematisch. Was Punk ist, sagte keine Band so gut wie Szenegröße WIZO: »Und kommt es vor, dass manche Wichser sagen wolln/ was Punk und nicht mehr Punk sein soll/ dann scheiß ich ihnen ins Gesicht/ neue Regeln brauch ich nicht.« Da wird einer akademischen Betrachtung vorausschauend der Boden entzogen. Dennoch: Wenn ein solches Unterfangen gelingen soll, dann so, wie es im Buch »Punk in Deutschland« angegangen wurde. Das auch, weil die Herausgeber Philipp Meinert und Martin Seeliger sich der Unmöglichkeit einer fassbaren Bestimmung ihres Forschungsgegenstandes bewusst sind.
Beide Herausgeber sowie alle Autoren sind der Szene nahe genug, um ihre Destruktionskraft als Kreativität würdigen zu können und sind ihr fern genug, um objektiv über sie reflektieren zu können. Zu Recht wird festgestellt, dass Punk sich am ehesten definieren lässt in Abgrenzung zu repressiver Macht: Stets geht und ging es in der Bewegung gegen den Staat, dessen Exekutivorgane sowie gegen Nation, Nazis, Religion und Krieg. Der positive Bezug auf Anarchie als Utopie, wie auch immer sie verstanden wird, liegt fast auf der Hand und Peter Seyferth hat keine Mühe, darauf einen selbstkritischen, antikapitalistischen Beitrag aufzubauen, fußend auf biografischen Erfahrungen.
Dass Personen und Bands wie Tobias Scheiße, Terrorgruppe oder Alkohol & Socken einmal in der Publikation eines Wissenschaftsverlags auftauchen, verdanken sie ihrem Engagement für die vermeintliche Spaßpartei APPD (»Balkanisierung, Rückverdummung, nie wieder Arbeit!«), die von Philipp Meinert vorgestellt wird. Ein Beitrag vom Paderborner Kulturwissenschaftler Christoph Jacke ist sehr lesenswert, obwohl er weit in den von Punks häufig verabscheuten Pop eintaucht.
So richtig seriös ist der Sammelband dann aber zumindest stilistisch nicht geworden. Warum auch? Konsequenterweise wird in bester Tradition des Forschungsgegenstandes auf Einzwängung durch Regeln verzichtet: Orthographie unterdrückt Kreativität. Wahllos eingestreute Wörter und Interpunktion nach Zufallsprinzip werden ergänzt durch sinnfreie Quellenbelege. Der Bezug des Punk zur Theorie ist oft stark konstruiert. Beispielsweise wenn der Skatepunk aufgrund seines Internationalismus mit einem Marx-Zitat zur Globalisierung eingeführt wird. Macht aber alles nichts. Das Buch ist gut geworden und mit besonders viel Gewinn werden es sicher alle lesen, die die Szene bereits von innen kennen gelernt haben und sich nun noch einmal ihrer eigenen Jugend versichern wollen. Fast steht es für das alte Punk-Prinzip des Do-it-yourself: selbst gemacht aus der Szene für die Szene.
Philipp Meinert/ Martin Seeliger (Hg.): Punk in Deutschland. Sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektiven. transcript Verlag. 312 S., br., 29,99 €.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.