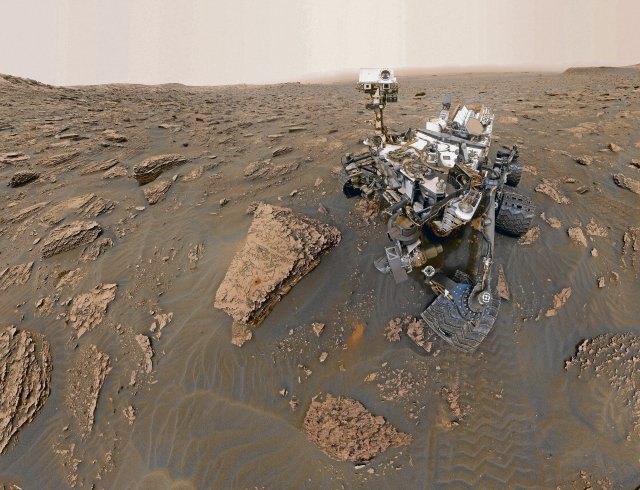Kinder, Tiere - und er
Zum Tode des großen deutschen Theaterschauspielers Gert Voss
Es mutet seltsam an, die Schauspielkunst als lebensgefährliche Arbeit zu bezeichnen. Das ist zunächst so, als wolle man, nur weil Dramatiker Ödön von Horváth von einem herabfallenden Ast erschlagen wurde, auch die schriftstellerische Existenz kurzschlüssig als lebensgefährlich bezeichnen. Aber wer Gert Voss in seinen großen Rollen sah, der wusste, was der europäisch vielfach ausgezeichnete Wiener Burgschauspieler meinte, wenn er von diesem Streben nach Lebensgefährlichkeit sprach. Für den Zuschauer nämlich gehe es um den Bannstrahl, den ein Darsteller von der Bühne sende, dieses Empfinden, dass jeden Moment etwas Unvorhergesehenes geschehen könne. Als geschehe der Theatermord gleich wirklich. Als verbrenne der Schauspieler im Feuer seiner Figur. Als gebe es nie wieder Deklamation, durchsichtige Schminke, nur noch Wahrhaftigkeit, wie sie uns aus den Erzählungen des Dämonischen und Zauberhaften entgegenschillert. Beim Schauspieler geht es darum, an einer Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation, Hingabe und Kontrolle so entlangzubalancieren, als habe er diese Grenze schon überschritten. Spielend die Dinge zeigen - aber doch deren Geheimnisse nicht verraten. Voss mochte alte Menschen, »von ihnen fällt das Unnötige, falsch Schmückende ab« - in dieser Bemerkung drückte sich die Philosophie seines Spiels aus.
Der epochengroße Darsteller wurde 1941 in Shanghai geboren. Wunderbar leicht und lebendig konnte er erzählen. Etwa von den Großeltern in China; der Großvater war Physiker, gab Vorlesungen (unter den Zuhörern Mao Tse-tung und Tschu En-lai), die Arbeit für die deutsche Kriegsindustrie brachte ihm, nach umgewandeltem Todesurteil, eine Haft von 268 Jahren Sibirien (»die Zahl werde ich nie vergessen«). Voss’ Vater war Kaufmann in China; auf einem gigantischen US-Truppentransporter erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg die Überfahrt ins zerstörte Deutschland. Es sei dann sein größter Erfolg gewesen, so Voss, die Schule überstanden zu haben. Das weitere Leben: ein rigoroses Da-Sein in der Kunst, für die Kunst. Voss ist einer jener Seltenen gewesen, die aus den Konflikten der realen Welt stets unberührter hervorgingen als aus der Kunst, die aus diesen Konflikten entsteht. Er wirkte wie jemand, der einzig beim Spielen tief vom Sein getroffen wird, »draußen« in der Realität aber nur auf lauter Schein trifft, den man vernachlässigen kann. Die Bühne als Schutzraum für das Ausleben totaler Schutzlosigkeit.
Nach dem Schauspielstudium erste, mürbende Wege durch Provinzen zwischen Konstanz und Braunschweig. Eine Existenz, die vor allem auf eines zielte: sich in elenden Anpassungsprozessen nicht »das eigene Herz zu brechen«. So entstand ein Künstler mit beständigem Verantwortungsgefühl für die eigene Erwartung, das heißt: Er ließ sich die eigenen Maßstäbe nicht zerreiben von den Mühlsteinen der Routine. Voss blieb spielend dem Menschen treu, so, dass wir dessen Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit liebten - sich aber zugleich all das offenbarte, was wir in uns so fürchten, hassen, verdrängen.
Voss’ Othello: das fremde, staunende Tier, das ohne Talent zum Misstrauen, ohne Empörungsgabe durch die Welt läuft. Der Tschechowsche Iwanow: vielleicht der wesenloseste, nebelschwadenhafteste Mensch, den man je auf dem Theater sah. Ibsens Rosmer: straff, streng zum Körper werdende Kälte der ideologischen Verführungskunst. Oder Becketts Hamm: im Moment, da ein Blinder sich die Brille putzte, sahst du die ganze Doppelbödigkeit der Welt. Immer, wo Voss in seinen Rollen das Schreckliche zeigte - etwa bei seinem legendären »Richard III.« vor fast dreißig Jahren -, fragte er, ob dies Grausame nicht im tiefsten Grunde jenes Hilflose sei, das Hilfe will. In Claus Peymanns legendärer Wiener Thomas-Bernhard-Inszenierung »Ritter Dene Voss« gab er einen Philosophen zwischen Wahn und Wahrheitsschärfe, zwischen schneidender Gemeinheit und armseliger Kreatürlichkeit; weinend vor schmerzender Lebensklarheit schlägt er den Kopf auf eine Tischplatte - Glücksmomente des Theaterschauens: Tanz auf straffsten Nervendrahtseilen. Voss spielte in atemberaubenden Varianten von Fiebrigkeit, Aggressivität und Erschöpfung die Vereinsamung eines Geistes, dem alles bewusst ist, und dessen eigener Wahnsinn doch immer so hellsichtig bleibt, dass darin der Irrsinn der Welt aufleuchtet.
Als Krapp in Becketts »Letztem Band«: ein glatziges, schalenloses Wesen, das der Vergangenheit nachträumt, als spräche es schon mit der Zukunft - dem Tod. Da sah er aus wie Woyzeck in Werner Herzogs Film - gespielt von Klaus Kinski: Nacktheit eines Ausdrucks, der die Trennwände aller Konvention einstürzen lässt. Ein Abend war das, den Voss mit seiner Frau Ursula, Autorin und Dramaturgin, und dem oftmaligen Bühnenpartner Ignaz Kirchner erarbeitete - in dieser Gemeinschaft grandioser Herr-und-Knecht-Konstellationen entstanden auch die Inszenierungen von Genets »Zofen« und eine Adaption von Simons »Sunshine Boys«: unbändige, intelligente Freude an der Suche, am Experiment.
Kleist hat er gespielt und Shakespeare, Goethe und Schiller, alles, was die Weltdramatik an Herausforderungen schuf. Bei Voss’ Entscheidungen für eine Rolle durfte man an den Teufelspakt zwischen Faust und Mephisto denken, an jene Szene, da der Satz fällt vom Blut, das ein ganz besonderer Saft sei. Arbeit ist Vampirismus, ein gegenseitiges Aussaugen zwischen Text und Interpret, Dichter und Darsteller. Schau-Spiel gleichsam als riskante Versenkung in eine geistige wie körperliche Vorstellungswelt - eine Versenkung, die aber nie vergessen ließ, dass zugleich ein kluger, technisch hochstehender Kontrollmechanismus ablief. Ein Steineklopfer und Seiltänzer, dieser Voss - der für jeden Bühnenpartner eine Herausforderung, eine Zumutung war. Wer ihm folgen wollte, der musste mit hinein in alle Hässlichkeiten, alle Abstoßungsfelder, alle höllischen Einsamkeiten eines seelischen Spiel-Feldes.
Ein gefährlicher, nackter Schauspieler sei das, so sagte es George Tabori. Und von einem britischen Kollegen war zu lesen, es gebe drei Wesen, an denen er auf der Bühne in tiefer Furcht verzweifeln würde: ein Tier, ein Kind - und Gert Voss. Schon als junger Kerl hatte dieser den uralten Firs in Tschechows »Kirschgarten« so gegeben, dass ihn unter der Maske niemand erkannte (unter der Maske des Spiels, nicht der Maske aus Schminke).
Kunstausübung betrieb der freundliche, witzige, liebenswürdige Gert Voss fernab aller Mühen, sich möglichst weit oben einzuschreiben in irgendwelche Listen der Aufmerksamkeit. Einen Star nannte ihn die Stadt Wien, in Tonlagen zwischen hütestrenger Eifersucht, vereinnahmender Beglücktheit und einer Zuneigung, die auch etwas Generöses hatte: Denn Voss war ja Zugereister, ein Deutscher, er gehörte zu jener Truppe des »Piefke« Peymann, die ihren Weg zum Triumph durch unverhohlene oder tückisch getarnte Ablehnung gehen musste - weil sie ab 1986 mächtig Staub aufwirbelte in Österreich; das intelligent-respektlose Aufstampfen von Peymann, Voss und Co. hatte im Heiligtum Burg gehörig Trägheit und Gewöhnungsmuff aus den traditionsschweren Kulissen geschüttelt.
Stuttgart, Bochum, Wien. Die großen Stationen, vor allem mit Claus Peymann. In der Sparte der graziösen Gaukler, dieser Komödianten in allen Tragödien, war Voss ein Olympier, und er wurde zwangsläufig zum Partner anderer bedeutender Regisseure: Zadek, Bondy, Tabori, Breth. Er war einer aus dem Geberland Kunst. Denn Kunst gibt - dem Bösen das Gute, dem Guten das Böse. Man nahm bei den Verwandlungen des Gert Voss nichts hin, ohne immerfort dessen Gegenteil zu denken; was am ehrlichsten daherkam, erweckte das größte Misstrauen, und noch im Schäbigsten lebte eine erzählenswerte Hoffnung. Am Sonntag ist dieser große deutsche Schauspieler mit 72 Jahren in Wien gestorben.
Hans-Dieter Schütt ist Autor des Buches »Gert Voss: Ich würd gern wissen, wie man ein Geheimnis spielt«. Verlag Schwarzkopf & und Schwarzkopf Berlin.

Wir behalten den Überblick!
Mit unserem Digital-Aktionsabo kannst Du alle Ausgaben von »nd« digital (nd.App oder nd.Epaper) für wenig Geld zu Hause oder unterwegs lesen.
Jetzt abonnieren!
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.