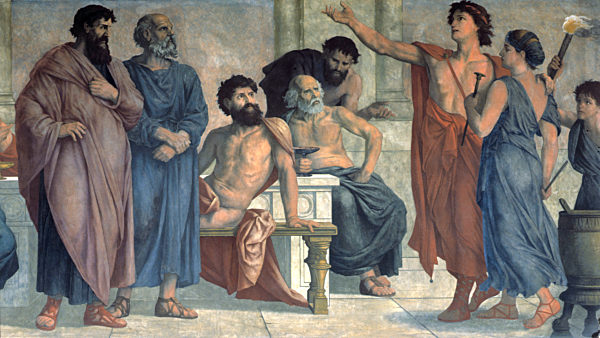Ort der Gegensätze
Das Achtung-Berlin-Filmfestival präsentiert Produktionen aus der Hauptstadt
Wenn junge Touristen Berlin besuchen, steigen sie meist im Hostel ab und tanzen sich dann durch die namhaften Clubs der Hauptstadt. In dem Spielfilm »Lost in the Living« lernt der junge Musiker Oisín Berlin ähnlich kennen. Mit seiner Band ist er aus Dublin gekommen, um eine Club-Tour durch Europa zu starten. Doch dann trifft er die 19-jährige Sabine (Aylin Tezel), zieht mit ihr durch die Stadt und lässt die Tournee sausen.
So filmt Regisseur Robert Manson in seinem Debüt Berlin, ohne sich dabei an den üblichen Sehenswürdigkeiten abzuarbeiten. Wie die meisten Werke des Festivals »Achtung Berlin« wurde dieser Film mit geringem Budget gedreht und macht daraus eine Tugend: indem er beweglich ist und sich voll auf seine beiden Protagonisten konzentriert. Doch nicht alle der etwa 70 langen, kurzen und mittellangen Spiel- und Dokfilme des Festivals spielen in Berlin. Als Auswahlkriterium reicht der Produktionsstandort Berlin oder Brandenburg, wie bei dem deutsch-dänischen Film »Limbo«, einer DFFB-Koproduktion.
Mittlerweile geht das Berlin-Festival des jungen, dynamischen Films in sein elftes Jahr. Große Produktionen, epische Geschichten sucht man hier vergebens. Mit Fantasie, Witz oder Teamarbeit bietet man besser finanziertem Kino die Stirn. Die Geschichten der jungen Regisseure entsprechen oft ihrem eigenen Horizont: Liebe, Reisen, Erfahrungen sammeln. Dennoch wird Berlin nicht idealisiert. Betrachtete Oisín (Tadhg Murphy) in »Lost in the Living« die Stadt anfänglich durch die rosa Brille des Verliebtseins, wird er sie später, als abgebrannter Obdachloser, von ihrer brutaleren Seite kennen lernen. So erscheint Berlin als Ort der Hoffnung und des Scheiterns zugleich.
Aus einem Club wird Oisín, zugedröhnt, hinausgeworfen. Doch wer sind eigentlich solche Türsteher, die darüber entscheiden, wer in einen angesagten Club hineindarf und wer nicht? Die Schwarz-Weiß-Doku »Straßensamurai« von Samer Halabi Cabezón porträtiert fünf von ihnen. Sie schieben Dienst in Berliner Locations wie »Gretchen« oder »SO 36«. Sie sind Menschenkenner, verbale Vermittler - aber auch Kampfsportler. Denn wer sich in diesem Job gegen alkoholisierte oder aggressive Nachtschwärmer nicht physisch durchsetzen kann, hat schon verloren. Dennoch zeigt der Film seine Helden vor allem von ihrer privaten Seite: zu Hause, beim Training, Philosophieren, auf nächtlichen Autofahrten durch die Szenekieze, mit ihren Kindern.
Dass in der Partymetropole Berlin allerdings auch einiges im Argen liegt, thematisiert das Drama »Nachspiel« von Andreas Pieper. Dessen Held Cem (Mehmet Atesci), ein Neuköllner Deutschtürke, ist Pfleger im Altersheim, Revoluzzer und Stürmer im Amateurfußball. In Wettkämpfen gerät er ständig mit dem Rechtsradikalen Roman (Frederick Lau) aneinander. Ausländerfeindlichkeit, Liebe und Gentrifizierung sind die Themen dieses Berlin-Films, der jedoch an Überfrachtung und Pathos scheitert.
Dass auch die so genannten jungen Kreativen ihres privilegierten Lebens überdrüssig werden können, zeigt wiederum der Eröffnungsfilm »Lichtgestalten« (Regie: Christian Moris Müller). Katharina (Theresa Scholze) und Steffen (Max Riemelt), ein Paar Anfang dreißig, merkt, dass es vor lauter Saturiertheit keine Träume mehr hat. Die beiden wollen aussteigen aus ihrem abgesicherten Spießerleben, zerlegen ihr Mobiliar, verbrennen ihre Fotoalben, verschenken ihr Geld - und bekommen plötzlich Angst vor der eigenen Courage. Gibt es so etwas wie ein völlig selbstbestimmtes Leben? Das Drama eruiert diese Frage mit Verfremdungen wie Klang- und Bildmontagen oder Zeitlupen und spielt kammerspielartig ausschließlich in dem Apartment der beiden. Erst am Ende vollführt die Kamera einen Schwenk über die schicke Dachgeschosswohnung hinaus - auf die Dächer der Partystadt Berlin.
15. bis 22. April in den Kinos Babylon-Mitte, FaF, Passage u.a.; Infos unter www.achtungberlin.de
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.