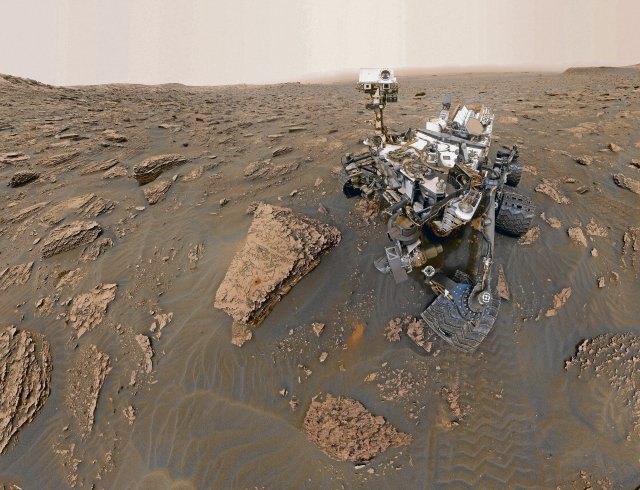Zwei Schwesternunwesen
Theatertreffen: »John Gabriel Borkman« vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg
Theodor Fontane schrieb kopfschüttelnd über die Alten: »Dieses am Ruder bleiben Wollen/ In allen Stücken und allen Rollen,/ Dieses sich unentbehrlich Vermeinen/ Samt ihrer ›Augen stillem Weinen‹,/ Als wäre der Welt ein Weh getan -/ Ach, ich kann es nicht verstahn.« Was beim deutschen Dichter noch einen Anhauch von Sanftheit hat, wird beim Norweger Henrik Ibsen zum schroffen Aburteil: Das Alter ist ein Krake, der krallt sich an die Jüngeren, will bei denen die eigenen Erfahrungen einlagern, als seien es Erlösungskeime. Aber das Alter vermag bei jeder Berührung eines anderen Lebens doch nur immer Gift und Galle, Zweifel und Zerfressenheit übertragen.
Eigentlich kann man Ibsens »John Gabriel Borkman« auf diesen bösen Punkt bringen. Es ist die Geschichte eines Bankiers, der im Gefängnis saß, weil er Geld seiner Anleger veruntreute. Schließlich Intrige, Verhaftung, Ehrverlust. Borkman: der Ideengigant, der sich als Opfer gesetzgeberischer Mittelmäßigkeit fühlt. Wieder in Freiheit, bleibt er Gefangener, er tappt jahrelang durch sein Zimmer wie ein Schicksalsgefesselter, unten im Erdgeschoss Ehefrau Gunhild. Die nur an Rache denkt, deren Vollstrecker Sohn Erhart sein soll. Er war nach dem Zusammenbruch des Borkman-Imperiums von Gunhilds Schwester Ella aufgezogen worden - nun steht diese unerwartet vor der Tür, will das Kind zurück, denn, todsterbenskrank, bedarf sie eines letzten menschlichen Halts ...
Am Deutschen Schauspielhaus Hamburg hat Karin Henkel (Bühne: Katrin Nottrodt) das Stück inszeniert. Radikal unwirklich. Hochgedreht psychentief. Stilsicher unaktuell (Banken, Spekulation, Krise) - aber doch enorm akut. Der Besitzende - Borkman - ist der Besessene, sein Dasein verkündet: Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit - Borkman bleibt noch in der tiefen Einsamkeit seiner Zimmerzelle ein verblendet Wartender, der jeden Moment damit rechnet, von denen, die ihn einst richteten, zurückgebeten zu werden ins Geschäft. Aber niemand kommt. Das ist sie, jene belustigende Tragödie, die aus jeder abgewrackten Hierarchie, aus dem Gehabe eines jedes Abgewählten herauskalauert, aus der Comeback-Gymnastik eines jeden Menschen, der aus Geschäft und Geltung und Geschichte gejagt wurde.
Josef Ostendorf spielt diesen Bankier - der zunächst weit hinten wie aufgebahrt liegt, als gebe er das bemitleidenswerte Menschenopfer - als aufreizend fläzigen Arroganzklumpen, der sich mit illusionärer wirtschaftlicher Begehrenskultur jene kurze Ewigkeit vertreibt, die ihm noch bleibt. Einer, der kraftstrotzend müde und zugleich mahlwerksgeil durch den Raum wabert und wabbelt. Die Sprache ein Knautschen und Zerkauen der Vokale, die Worte wie Fische, nach denen ein Bärenmaul schnappt. Ein Komiker der Krise, der Luftgitarre spielt; ein Kauz des verzögerten Kollapses, der sich in Wolfsgeheul hineingrimmt. Bis der selbstwertlädierte Vertraute Wilhelm (leidenschaftlich lappig: Matthias Bundschuh), ein Kleinangestellter mit unerfüllten Dichterträumen, mit klaren Worten die Realitätsferne von Borkmans Machtfantasien ausspricht. Da geht in dessen Inneren wohl eine unsichtbare Lawine der schlimmen Erkenntnis nieder, und, eiskalt getroffen, erklärt er den so armselig auf Ruhm hoffenden Wilhelm zu einem poetischen Stümper. Ein komischer gegenseitiger Lebenslügen-Klau. Ein trauriges Maskenreißen.
In Henkels Inszenierung pocht, peitscht, poltert, paradiert ein hochwitzig zelebrierter Theatergruselgeist vom Feinsten. Schritte werden Donnergrollen. Atemzüge sind wie Kettenrasseln. Geschlechterkampfwilde und Zerrissenheitszombies präsentieren ein traumhaft trümmergieriges Abtötungsverfahren. Eine Mechanik, die so bestürzt, wie sie lachen macht. Keine Realität. Kunstwelt. Aber diese so, dass man inmitten der Übertreibungen ein sehr starkes Gefühl für die realen Spannungen zwischen Liebe, Geld und Macht bekommt.
Die Bühne ist eine Gruft mit steinerner Treppe, als sei der Tod eine Revue, getanzt, geschlurft von Gespenstern. Dämmerung. Hier lebt nichts mehr. Höchstens vielleicht der Plüschbär, der alsbald massakriert wird. Lina Beckmann als Ella und Julia Wieninger als Gunhild liefern sich, im Knitterschauder ihrer Halbmasken, ein hass-hässliches, mitunter turnerisches Duell um die Hoheitsrechte am Jungen Erhart (Jan-Peter Kampwirth). An dessen Pulloverarmen beidseitig gezerrt wird, dass er wie ein Gekreuzigter aussieht, freilich so, dass Jesus die Bildrechte an dieser Positur sofort zurückziehen würde. Beckmann und Wieninger: Furien der Vergeblichkeit, zwei Schwesternunwesen, die noch zum Schlussapplaus, trappabhüpfend, alleinvertretungsstur herumkreischen: »Mein Applaus! - Nö, meiner!«
Karin Henkel ist eine Regisseurin, die auf sehr eigene Weise nach Bitterstoffen im Fleisch von Komödien sucht, nach dem Witz in allem, was zum Weinen ist. Regietheater, was sonst! Bau von Bildern, Komposition von Körpern, Übersetzung von Sinn in Sinnlichkeit. Neuaufmischung alter Stoffe. Grotesk und schauspielerfestlich. Soeben erhielt Lina Beckmann den 3sat-Preis des Theatertreffens, und ihr gehört eine der herrlichsten Szenen der zweistündigen Aufführung: Nach acht Jahren sehen sich Ella und Borkman wieder, die Steintreppe wird zur eckig unbeholfenen Annäherungsgala einer Frau im Negligé, die minutenlang alle Klischeeposen weiblichen Reizes durchspielt und -stolpert; eine Monroe aus Detmold oder eine Dietrich aus Grimma; kitsch me if you can - aber ohne dass Borkman auch nur mit der Wimper zuckt.
Jeder ist hier Spieler und Krieger. Tote Seelen im Wiederbelebungsclinch. Der Schmerz als letztes Refugium des wahren reinen Empfindens: gar nichts mehr zu fühlen. Um das Leben zu erzählen, genügt zu sagen: Es tut weh. Das ist Irrsinn, das ist paradox, das ist nicht zu fassen, aber es ist wohl wahr. Der Kopf schreit, das Herz blutet. Des Menschen innere Gewaltenteilung. Brecht sagte, es sei anstrengend, böse zu sein. Henkel widerlegt ihn mit Ibsen. Wo es unmöglich wurde, gut zu bleiben (und friedfertig ins eigene Alter zu sinken), da ist es überhaupt nicht anstrengend, böse zu sein. Da ist es Lebenselixier - das Leben tötet.

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.