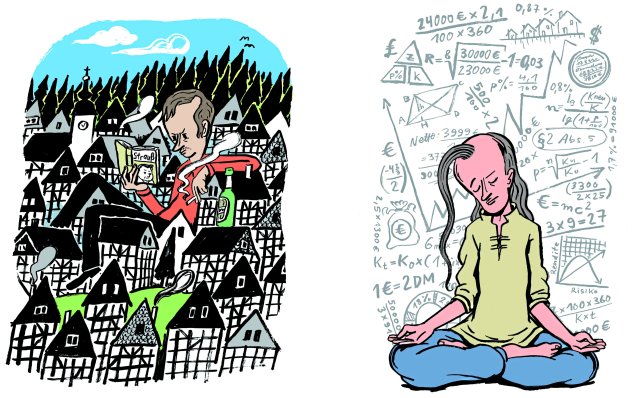Anarchisch geordnetes Spiel der Zeichen
Die Kunstbibliothek Berlin entdeckt Jean Dubuffet
Es soll ein Publikum geben, das im Berliner Kulturforum geradewegs zu Gemäldegalerie und Kupferstichkabinett pilgert und noch nie links unter der Cafeteria einen Blick in die Kunstbibliothek gewagt hat. Selber dran schuld - denn so manche künstlerische Kostbarkeit war da die letzten Jahre in dem schön übersichtlich intimen Ausstellungsraum aufbereitet. Wer sich ein Gespür für grafische Feinheiten bewahrt hat, kommt hier allemal auf seine Kosten. Selbst jetzt, da die Gemäldegalerie mit der imposanten Botticelli-Sonderschau sich selbst übertrifft, sollte man einen Blick zur Seite riskieren, und sich das abenteuerliche Vergnügen gönnen, das bereits vor dreißig Jahren verblichene künstlerische Original Jean Dubuffet in seinen Künstlerbüchern zu entdecken.
Dazu verhilft nämlich diese Ausstellung auf so umfassende und vielseitige Weise, wie es selbst in der französischen Heimat des Ausnahmekünstlers, geschweige denn anderswo, kaum möglich sein dürfte. Erstaunlich schon, wie viele Beispiele die Kuratorin Laura Gieser in den Beständen der veranstaltenden Kunstbibliothek selbst fand. Wer hat sie das letzte Mal zur Hand genommen oder gar vorgezeigt, all die lithografierten oder serigrafierten Druckwerke von ganz besonderer Güte? Wenn ein Künstler innerhalb der klassischen Moderne so viele Spielwiesen bediente wie dieser, besteht immer die Gefahr, das malerisch und skulptural Überdimensionierte überzubewerten. Dubuffet ist als geistvoll fantasierender Zeichner viel variabler als in dekorativen Flächen und raumgreifenden Gebilden. Zumal sein kurioser Charakter sich da viel unmittelbarer äußert.
»Es sollte eine innere Zeichnung werden, von innen heraus kommend, sie sollte sogar ins Fleisch der Objekte gehen, innerlich und diffus.« Wer sich so äußert, will von der Oberfläche auf den Kern der Dinge kommen. Doch: »Ich sehne mich nach einer Kunst, die direkt aus unserem gewöhnlichen Leben wächst.« Von realen Dingen kommend, surreale Gebilde zeichnend, ist er ein begnadet naiv Zeichnender vor dem Herrn. Ja, vor dem Herrn Zeitgeist der 40er bis 70er Jahre, dessen Geist in Paris getrost mit Esprit zu übersetzen wäre. Was auf den ersten Blick wie gegenstandslose Anarchie anmutet, wird durch den Druck auf Papier wieder Gegenstand. Das entrückte, ja verrückte Spiel des Schwarz-Weiß in Strich und Linie, Fleck und Ballung wird in klarer Form gebändigt. Die persönliche Handschrift bleibt in geschriebenen Zeichen und Sätzen immer präsent.
Fünfzehn lange Vitrinen, prall gefüllt mit vielerlei Druckwerken, stehen frei im Raum. Die Wände schmücken sich mit grafischen Zyklen. In »Materie und Gedächtnis« zeichnet er 1944 eine Schule der Lithografie als »Lithografie in der Schule« in 18 witzigen Varianten. In der Litho-Werkstatt »Mourlot Freres Paris« arbeitet neben ihm Picasso. 1945 folgen mit »Les Murs« die Adaptionen von zwölf Gedichten von Eugene Guillevic. Illustriert Dubuffet? Nein. Vielmehr illuminiert er, will heißen, er erhellt den Gehalt mit grafischen Geistesblitzen. 1950 offenbart ihm das filigrane grafische Flechtwerk arabischer Schriften eine ganz neue Welt, und er spinnt in »Labonfam« daraus sarkastisch erotische Graffiti. Dubuffets Spuren münden später sowieso in den heute genormten Formenkanon unserer »Street Art«.
Denn 1962 bis 1974 kam der Siegeszug der Serie »Hourlupe«, deren polyphones Puzzle aus Rot-weiß-blau-schwarz ein gerastertes Farbfeuerwerk über die Papierseiten hinaus auf ganze Hauswände und Platzgestaltungen übertrug. Flankiert von plastischen Objekten, wurde das geradezu eine Dubuffet-Inflation, die auf den frühen »Documenta«-Schauen in Kassel für Aufsehen sorgte. Mit dem Stempel »art brut« versehen wurde er zur Marke. 1967 hat er das mit dem tiefschwarzen Marker in der »Parade funebre für Charles Estienne« wieder auf seine elementaren Ursprünge reduziert. Indem er beim Zeichnen jazzartig rhythmisch bewegt agierte, kam er seinem Ideal einer Lautmalerei nahe. In den Serigrafien der späten Jahre realisierte er wiederum neue Varianten grafischer Chiffren.
Was macht den französischer Maler, Bildhauer, Collage- und Aktionskünstler Dubuffet so außergewöhnlich? Der 1901 in Le Havre im exquisiten Milieu von Weinhändlern Geborene wollte immer das »enfant terrible« sein. Jahrzehntelang redete er vom Beispiel der Kinder und Geisteskranken, blieb als Künstler aber erfolglos. Da hat er halt wieder mit Wein gehandelt. Im Krieg muss er erwacht sein. Sein vierzigster Geburtstag jedenfalls gab das Startsignal, hier erkennen wir es. Und alles, was wir nun hier sehen, gibt den Schlüssel zu seinem Wesen. Die Lust, auf der Fläche des Papiers zu spielen, als »homo ludens« alles Lebendige und scheinbar Leblose formend zu umspielen - allein das war für ihn wesentlich.
Monsieur Jean Dubuffet in der Kunstbibliothek. Eine Ausstellung der Kunstbibliothek Staatliche Museen zu Berlin, bis 17. Januar 2016, Di-Fr 10-18 Sa/So 11-18 Uhr.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.