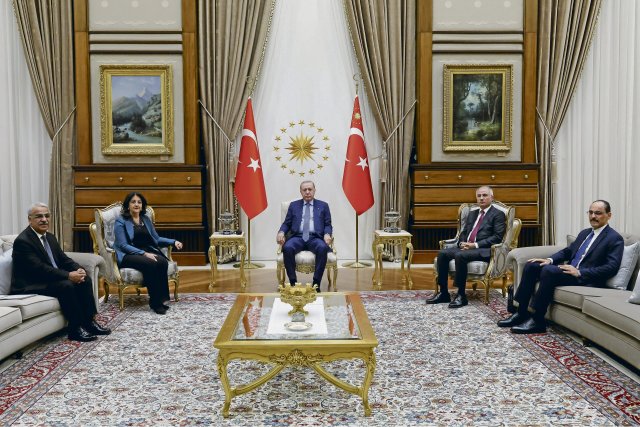Russlands »Personen des Jahres«
Merkel mit Pugatschowa auf einer Liste und Putins »Worte, die die Welt verändern«
Liest die deutsche Bundeskanzlerin Moskauer Zeitungen? Wenn ja, weiß sie inzwischen, dass auch die Russen sie bei Umfragen zur »Frau des Jahres« kürten. Doch in dem Freudenbecher sind gleich zwei Wermutstropfen enthalten. Angela Merkel muss sich den Sieg mit Valentina Matwijenko teilen, der Präsidentin des russischen Senats - und beide Damen sammelten nur jeweils sechs Prozent ein.
Anders die Herren. Sowohl beim Lewada-Zentrum, derzeit das einzige unabhängige Meinungsforschungsinstitut Russlands, als auch bei der staatsnahen Konkurrenz siegte Wladimir Putin mit großem Abstand zur Verfolgergruppe. Bei der Lewada-Umfrage lag der Präsident mit 56 Prozent vorn. Außenamtschef Sergej Lawrow stieg mit zehn Prozent auf Rang zwei, dicht gefolgt von Sergej Schoigu. Der Kollege Verteidigungsminister kam auf acht Prozent. Ministerpräsident Dmitri Medwedjew und der einflussreiche Chef der Kremladministration Sergej Iwanow rutschten dafür auf die Plätze vier und fünf ab.
Medwedjews schlechte Vorstellung erklären die Meinungsforscher mit wachsender Unzufriedenheit. Die Befragten meinten, die Regierung tue zu wenig gegen Krise und Inflation. Eine indirekte Bestätigung dafür bietet die Zustimmungsrate für Notenbankchefin Elvira Nabiullina. Sie liegt bei knapp einem Prozent. Nicht nur Jungstar Polina Gagarina, auch ihre Sangeskollegin Alla Pugatschowa, alternde Pop-Ikone der Sowjetära, brachten vier bzw. zwei Zähler mehr auf die Waage.
Der Kremlchef dagegen konnte trotz Flaute sein Ergebnis in nur zwei Jahren mehr als verdoppeln. 2013 hatten ihn ganze 26 Prozent zum »Mann des Jahres« gewählt. Die Lewada-Soziologen erklären das Phänomen mit einem massiven Druck des Westens. In Treue fest zum Herrscher zu stehen, wenn Mutter Heimat in Bedrängnis sei, gehöre zum russischen Erbgut.
Außenminister Lawrow dagegen punktete für seine Rolle im Syrienkonflikt und vor allem mit seinen Bemühungen um die Minsker Vereinbarungen zur Beilegung der Ukrainekrise. Hinzu kam die erfolgreiche Vermittlung im Streit um das iranische Kernforschungsprogramm.
Die Syrien-Operation vornehmlich der russischen Luftwaffe ist auch der größte Posten auf der Habenseite des Verteidigungsministers Schoigu. Mit einem militärischen Sieg Moskaus, glauben Beobachter, werde Schoigu seine erbittertsten Gegner abhängen. Schon jetzt gilt er als aussichtsreichster Bewerber um die Putin-Nachfolge.
Beim Ranking der 100 einflussreichsten Politiker Russlands, das die »Njesawissimaja Gaseta« bei einer staatsnahen Denkfabrik in Auftrag gab, landete Schoigu indes nur auf Platz sechs und kassierte 6,24 von zehn zu vergebenden Punkten. Ministerkollege Lawrow liegt dort mit 7,02 Punkten knapp vor ihm. Ähnlich knapp landete Präsidentenamtschef Iwanow vor Premier Medwedew. Rang drei ging an Wjatscheslaw Wolodin, die im Ausland wenig bekannte graue Eminenz der Kremlpartei »Einiges Russland«. Patriarch Kyrill ging als achter durchs Ziel, der bestplatzierteste Oligarch - Arkadi Rotenberg - als 27. Der einflussreichste Oppositionspolitiker ist demzufolge KP-Chef Gennadi Sjuganow. Er belegt Rang 34. Von den Liberalen schaffte es niemand auf die Liste. Sieger Putin dagegen fuhr ein Traumergebnis ein: 9,92 Punkte.
Das könnte auch daran liegen, dass er sich sprachlich zuweilen Geschmacksverirrungen leistet wie der gemeine Wähler. Den ersten rhetorischen Knaller landete er gleich nach seiner Bestellung zum Regierungschef im Sommer 1999, als Moskau zum zweiten Mal gegen die Rebellenrepublik Tschetschenien ins Feld zog. »Wir«, so Putin wörtlich und meinte die Separatisten, »werden sie notfalls auf dem Lokus massakrieren.« Den oberen Tausend legt jetzt eine kremlnahe Stiftung eine Sammlung von Putin-Zitaten als Neujahrsgeschenk unter den Tannenbaum. Das 400 Seiten starke Werk trägt den Titel »Worte, die die Welt verändern«.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.